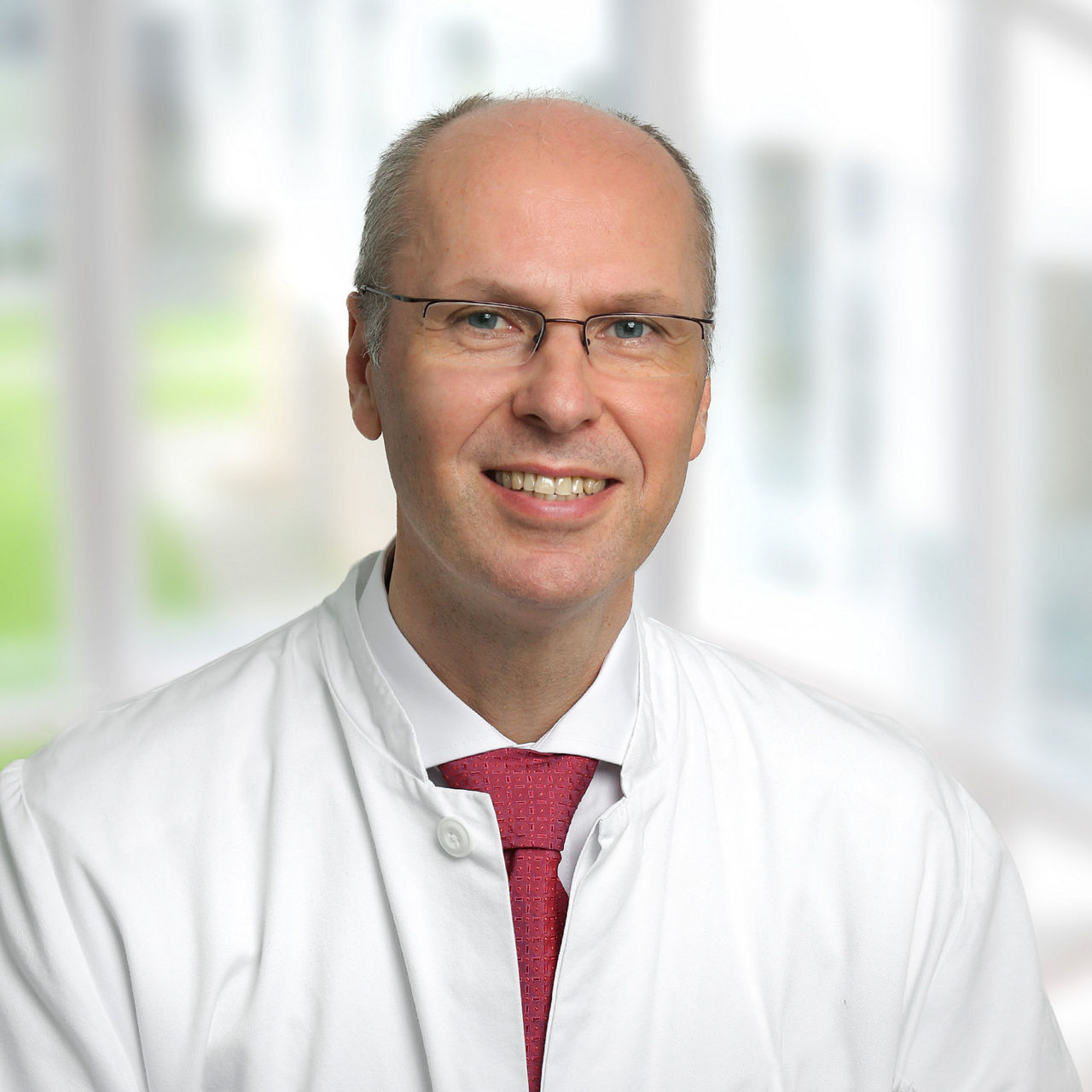Was ist eine Trichterbrust?
„Die Trichterbrust, auch Pectus excavatum, ist eine Fehlbildung des Brustkorbs, bei der das Brustbein im unteren Bereich einsinkt und sich nach innen wölbt", so Prof. Dr. Joachim Pfannschmidt, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie in der Helios Klinik Berlin-Zehlendorf. Die vordere Brustwand nimmt durch das Einsinken die Form eines Trichters an. In der Regel sind neben dem Brustbein vier bis fünf Rippen pro Seite betroffen. Je nach Ausprägung kann sie symmetrisch oder asymmetrisch eingesenkt sein. Während der Pubertät nehmen die Befunde deutlich zu.
Die Trichterbrust ist bereits bei Säuglingen erkennbar. Jungen sind viermal häufiger betroffen als Mädchen. Das Auftreten der Trichterbrust wird familiär gehäuft beobachtet.
Unterschied zur Kielbrust
Bei der Kielbrust (Pectus carinatum) wölben sich das Brustbein und die benachbarten Rippen nach außen. Die Vorwölbung tritt seltener auf und entwickelt sich oft erst mit der Pubertät. Im Vergleich zur Trichterbrust tritt die Kielbrust circa fünfmal weniger auf.
Die Ursache der Kielbrust ist ein übermäßiges Wachstum der Knorpelverbindungen zwischen Rippen und Brustbein. Betroffene leiden in der Regel unter starken psychischen Belastungen und Fehlbelastungen der Wirbelsäule, etwa Rückenschmerzen oder Skoliose (Deformierung der Wirbelsäule). Schränkt die Kielbrust die Atmung ein, ist eine Operation notwendig.
Trichterbrust erkennen: Symptome im Überblick
„Die meisten Patientinnen und Patienten im Kleinkindalter sind beschwerdefrei, da ihr Brustkorb noch relativ weich ist", sagt Prof. Dr. Pfannschmidt. Dennoch, mit zunehmender Festigkeit des Brustkorbs können diverse Symptome auftreten.
Symptome auf einen Blick:
- Brustschmerzen
- Kurzatmigkeit
- Belastungsabnahme
- Ausdauer und Durchhaltevermögen sinken
- Herzklopfen, gegebenenfalls auch Herzrasen
- psychische Auffälligkeiten
Ursachen und Risikofaktoren für eine Trichterbrust
Die Ursache für das Entstehen einer Trichterbrust ist eine Störung im Wachstumsverhalten der Knochen und Rippenknorpel im Bereich des Brustkorbs. Es kommt zum unkontrollierten Wachstum der Rippenknorpel, wodurch sich das Brustbein nach innen zur Trichterbrust oder nach außen zur Kielbrust wölbt.
Auch einer familiären Häufung ist eine erbliche bedingte Anlage zu unterstellen. Die genauen Ursachen sind jedoch unbekannt.
„In manchen Fällen können auch andere Erkrankungen eine Trichterbrust begünstigen. Dazu zählen etwa das seltene Marfan-Syndrom oder auch Skoliose", so Prof. Joachim Pfannschmidt.
- Skoliose: Die Wirbelsäule ist s-förmig zur Seite hin verkrümmt. Dadurch kann es zum Einsinken des Brustkorbs kommen.
- Marfan-Syndrom: Hierbei handelt es sich um eine angeborene Erkrankung des Bindegewebes. Patient:innen haben neben der eingesunkenen Brust häufig überproportional lange Arme und Beine, überdehnbare Gelenke, Herzklappenfehler und Augenprobleme.
- Poland-Syndrom: Die Brustdrüse und der Brustmuskel sind beim Poland-Syndrom auf einer Seite fehlgebildet, sodass die betroffene Brust kleiner als die gesunde ist. In diesem Zusammenhang tritt häufig eine Trichterbrust auf.
Diagnose Pectus Excavatum
„Bei einem Verdacht auf eine Trichterbrust sollten Eltern mit ihrem Kind zunächst die kinderärztliche Praxis aufsuchen", sagt Prof. Pfannschmidt. In einem ersten Gespräch nehmen Kinderärzt:innen die Anamnese (Krankengeschichte) auf und erfassen die Symptome. Zudem dokumentieren sie die Deformität mit Fotos aus verschiedenen Perspektiven.
Um festzustellen, ob durch die Verformung auch innere Organe wie Herz und Lunge beeinträchtigt sind, folgen weitere Untersuchungen.
- Magnetresonanztomographie (MRT): Die MRT-Untersuchung des Thorax (Brustkorb) dient der Bestimmung des Haller-Index. Dieser gibt das Verhältnis zwischen dem Quer- und Längsdurchmesser des Thorax am tiefsten Punkt des Trichters an. Je höher der Index, desto ausgeprägter die Trichterbrust. Gesunde Patient:innen kommen auf einen Wert von bis drei.
- Herz-Ultraschall: Zur weiteren Bestätigung des Befundes kann noch eine Herz-Ultraschalluntersuchung stattfinden. Diese soll zeigen, ob das Herz beeinträchtigt ist. Weitere Untersuchungen des Herzens sind die Blutgasanalyse, Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung sowie ein Elektrokardiogramm (EKG).
- Lungen-Untersuchungen: Auch die Lunge kann beeinträchtigt sein. Dazu wird bei der Diagnosestellung eine Lungenfunktionsmessung und wenn nötig, eine Leistungsmessung (Spiroergometrie) vorgenommen.
Trichterbrust behandeln: Was können Betroffene tun?
„Die Behandlung einer Trichterbrust richtet sich immer nach dem Ausmaß der Fehlbildung und dem Alter der Patientinnen und Patienten. Prinzipiell lässt sich die Deformität aber gut behandeln", sagt der Chefarzt der Thoraxchirurgie.
Konservative Therapie
Bei leichten Formen und jungen Patient:innen, die noch einen elastischen Brustkorb haben, können Physiotherapie und eine Saugglockenbehandlung nach Klobe eingesetzt werden.
- Saugglocke: Die Behandlung mit einer speziellen Saugglocke erzielt vor allem bei einer leichten Brustwandeinziehung gute Ergebnisse. Durch den erzeugten Unterdruck wird der Brustkorb der jungen Patient:innen angehoben.
- Physiotherapie: Insbesondere im Wachstum ist Physiotherapie eine gute Methode, um der Trichterbrust und einer damit verbundenen Fehlhaltung entgegenzuwirken. Ob die Verformung weg zu trainieren ist, hängt vom Haller-Index (mathematische Beziehung, die in einem menschlichen Brustabschnitt existiert) ab. Tägliches Training kann dabei helfen, den Burstkorb zu dehnen und die Körperhaltung zu verbessern. Am besten eigenen sich Übungen, die die Rücken- und Brustmuskulatur stärken sowie den Brustkorb aufdehnen.
Operative Therapie
Die Operation einer Trichterbrust erfolgt meist aus funktionellen, wie auch ästhetischen und psychischen Gründen. Dafür stehen verschiedene Verfahren einer minimalinvasiven videogestützten Operation zur Verfügung. Bei der sogenannten Nuss-Operation zur Behandlung eines Pectus excavatum werden ein oder zwei Metallbügel unterhalb des Brustbeins platziert, um das Brustbein anzuheben. Die Metallbügel werden nach drei Jahren in einer kleineren Operation wieder entfernt. Diese Methode eignet sich besonders für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren.
Nach der Operation können zunächst postoperative Schmerzen auftreten. Etwa zwei bis drei Wochen nach der Operation sind die meisten Patient:innen nur noch wenig eingeschränkt. Kontaktsportarten sollten für bis zu sechs Monate nach der Operation vermieden werden. Physiotherapeutische Schulungen beginnen direkt nach der Operation.
Leben mit Trichterbrust: Sind Betroffene eingeschränkt?
Bei ausgeprägten Formen der Trichterbrust kann es zu symptomabhängigen Leistungseinschränkungen kommen. Neben den körperlichen Beschwerden, leiden viele Betroffene unter psychischen Belastungen.
Ist die Eindellung sehr tief, kann es sein, dass innere Organe, wie das Herz oder die Lunge, verdrängt und in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Dies kann die Lebenserwartung verkürzen – sichere Langzeit-Untersuchungen liegen dazu aber nicht vor.
Übungen: Kann man die Trichterbrust wegtrainieren?
„Leider kann man eine Trichterbrust nicht einfach wegtrainieren, aber das Aussehen durch gezielte Übungen günstig beeinflussen", so Prof. Joachim Pfannschmidt.
Gut geeignet sind etwa Haltungstraining und Sport, um Beschwerden wie Brustkorbschmerzen positiv zu beeinflussen. Welche Übungen geeignet sind und wie man sie richtig ausübt, lernen Patient:innen in der Physiotherapie.