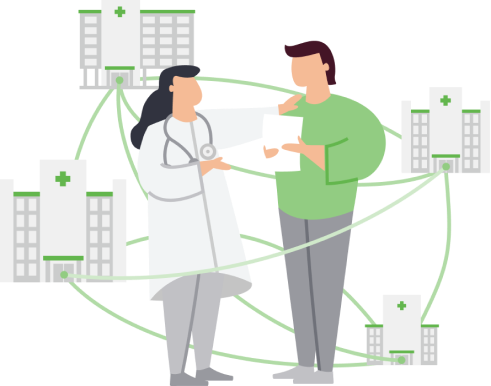Reha nach Darmkrebs
Der Start einer Rehabilitation nach einer Darmkrebs-Behandlung kann unterschiedlich sein: Bei einer Operation ist im Allgemeinen der letzte Tag im Krankenhaus gemeint, bei einer ambulanten Chemotherapie hingegen der Tag der letzten Infusion.
Neben der Anschlussrehabilitation gibt es die sogenannte medizinisch-onkologische Rehabilitation. Sie kann bis zu einem Jahr nach Abschluss der Akut-Behandlung begonnen werden und dauert ebenfalls drei Wochen. Beide Maßnahmen können in der Regel nur stationär in einer Reha-Klinik erfolgen, nur in Ausnahmefällen auch teilstationär (ambulant).
Krankheit und Beruf
Während der Rehabilitation werden wichtige beruflich relevante Belastungspunkte und Lösungsansätze besprochen. Es gibt unterstützende Therapien, Schulungen und Beratungen in Hinblick auf den Beruf der Patient:innen. Auch der konkrete berufliche Wiedereinstig oder eine Erwerbsminderungsrente werden Thema sein.
Die Patient:innen werden ihre berufliche Situation und Belastbarkeit durch die Rehabilitation selbst besser einschätzen können. Zusätzlich dient wiederum die ärztliche Einschätzung der beruflichen Belastbarkeit der Rentenversicherung als wichtige Entscheidungsgrundlage.
Die besonderen Möglichkeiten einer stationären Rehabilitation
Die Verarbeitung und Bewältigung einer Tumorerkrankung erfordert häufig Kraft und auch das Treffen wichtiger Entscheidungen. Die Zeit und Ruhe während der Rehabilitation nutzen viele Patient:innen, um ihre Krankheits- und Lebenssituation neu zu überdenken.
Sie spüren oft wieder zunehmende körperliche und seelische Kräfte und können ihre eigenen Möglichkeiten, aber auch die weiter bestehenden Grenzen mit Blick auf die Zukunft besser einschätzen.
Das Gespräch mit erfahrenen Ärzt:innen, Psycholog:innen, Therapeut:innen und Pflegekräften bietet dafür einen sinnvollen Rahmen. Aber auch das besondere Umfeld einer Klinik spielt eine große Rolle und kann diesen Prozess der Krankheitsbewältigung fördern.
Spaziergänge in der Natur, das Zusammensitzen abends im kleinen Kreis oder auch eine Kunstwerkstatt sind wichtige Gelegenheiten, um mit anderen Patient:innen ins Gespräch zu kommen. Der Austausch unter Gleichbetroffenen ist dabei von unschätzbarem Wert.
Viele Patient:innen sind positiv überrascht, wie hilfreich diese Kontakte für die Seele, aber auch für Alltagsfragen im Umgang mit der Erkrankung sind. Oft werden auch Schulungen von Patientenorganisationen angeboten, in denen alltagspraktische, aber auch intime Fragen in Zusammenhang mit der Erkrankung im geschützten Rahmen angesprochen werden können.
Eine stationäre Rehabilitation stellt somit auch eine wichtige Chance zur Krankheitsbewältigung dar.
Wer übernimmt die Kosten für die Reha?
Die Kosten für den Reha-Aufenthalt werden bei gesetzlich versicherten Patient:innen von den gesetzlichen Krankenkassen oder der gesetzlichen Rentenversicherung übernommen. Privat versicherte Patient:innen müssen die Kostenübernahme mit ihrer Versicherung prüfen.
Wichtig: In der Regel wird für die Reha eine Zuzahlung fällig. Diese beträgt zehn Euro pro Tag und ist privat zu tragen.
An wen kann ich mich wenden?
Der Antrag für die Rehabilitation nach einer Darmkrebsbehandlung sollte bei der Krankenkasse gestellt werden. Falls erforderlich, wird er von dort an einen anderen zuständigen Kostenträger weitergeleitet. Erfolgt die Reha in Form einer Anschlussrehabilitation, stellt der Sozialdienst des behandelnden Krankenhauses den Antrag.
Darmkrebs Nachsorge
Ebenso wie die Therapie ist auch die Nachsorge bei einer Darmkrebserkrankung davon abhängig, ob sich der Tumor im Dickdarm oder im Enddarm (Mastdarm) befunden hat und in welchem Stadium er diagnostiziert wurde.
Zudem spielt auch die Gradeinteilung („Grading“) eine Rolle, sprich: Die Frage danach, wie aggressiv und schnell die Tumorzellen gewachsen sind. Die Nachsorge ist unerlässlich um sicherzustellen, dass Komplikationen durch die Krebserkrankung oder ein möglicher Rückfall frühestmöglich erkannt werden.
Nachsorge für das UICC Stadium I
In der Nachsorge von Darmkrebs unterscheidet man eine allgemeine Tumornachsorge und eine rein koloskopische Nachsorge, sprich: die regelmäßige Darmspiegelung.
Welche Maßnahmen angebracht sind, richtet sich immer am Tumorstadium aus. So kann bei einem erfolgreich entfernten Dickdarmkrebs im Stadium I eine regelmäßige Tumornachsorge nicht nötig und die regelmäßige Darmspiegelung ausreichend sein.
Nachsorge für die UICC Stadien II und III
Die Nachsorge in den Stadien II und III findet regelmäßig statt, neben der Darmspiegelung werden auch weitere Untersuchungen vorgenommen. So ist die Bestimmung des Tumormarkers CEA („karzinoembryonales Antigen“) sinnvoll, um einen Rückfall frühzeitig zu erkennen. Aber auch Ultraschall-Untersuchungen finden über fünf Jahre im Abstand von sechs Monaten statt [1].
Untersuchungsmöglichkeiten während der Nachsorge:
Bestimmung des Tumormarkers CEA: Die S3-Leitlinie empfiehlt alle sechs Monate und über mindestens zwei Jahre die Bestimmung des darmkrebsspezifischen Tumormarkers CEA.
Darmspiegelung: Die große Darmspiegelung (Koloskopie) sollte optimalerweise bereits vor der Tumorbehandlung durchgeführt werden. Patient:innen, die vor der Therapie keine Koloskopie erhalten haben, wird sie erstmalig sechs Monate nach Therapieende empfohlen. Bei unauffälligem Befund sollte sie nach fünf Jahren wiederholt werden.
Bauch-Ultraschall (Abdomensonografie): Die Ultraschalluntersuchung ist laut S3-Leitlinie geeignet, um eventuell auftretende Metastasen in der Leber nachzuweisen. Die Untersuchung wird daher für die Nachsorge bei einem kolorektalen Karzinom empfohlen.
Röntgen des Brustkorbs (Röntgen-Thorax): Die Röntgenuntersuchung des Brustkorbes gehört alle 12 Monate zur Nachsorge der Darmkrebserkrankung. Ausnahmen stellen Rektumkarzinome im UICC Stadium II und III dar, bei denen die Röntgenuntersuchung bis zum fünften Jahr nach Therapieende vor allem zur frühzeitigen Erkennung von Lungenmetastasen jährlich empfohlen wird.
Computertomographie (CT): Die Computertomographie gehört nicht zu den regulären Nachsorgeuntersuchungen. Sie wird nur bei Rektalkarzinomen einmalig circa drei Monate nach Therapieende genutzt, um Bilder für den sogenannten Ausgangsbefund zu erstellen.
Kleine Darmspiegelung (Sigmoidoskopie): Die S3-Leitlinien empfehlen die kleine Darmspiegelung für Patienten mit Rektumkarzinom, die keine neoadjuvante oder adjuvante Radiochemotherapie erhalten haben. In diesen Fällen sollte sie in den ersten zwei Jahren nach Therapieende im sechsmonatigen Abstand insgesamt viermal durchgeführt werden.