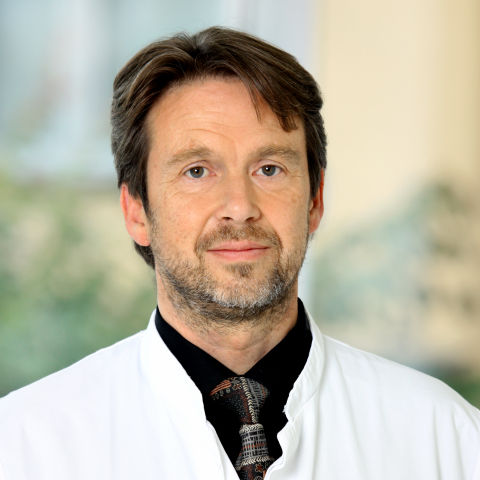Mo - Mi 09:00 bis 18:00
Do - Fr 09:00 bis 14:00
Sa 09:00 bis 12:00


Unsere Leistungen
Das Leistungsspektrum unserer Klinik umfasst die Diagnostik und Behandlung des gesamten Spektrums psychischer Erkrankungen.
Depressive Erkrankungen - Klinisches Bild
Depressionen unterscheiden sich deutlich von den auch bei Gesunden vorkommenden Zuständen, in denen nur kurzzeitig (für Stunden oder Tage) Beeinträchtigungen der Stimmung oder der Leistungsfähigkeit auftreten. Typische Anzeichen einer depressiven Erkrankung sind niedergedrückte Stimmung, Konzentrationsstörungen, Grübelneigung, Freudlosigkeit, ein Gefühl von Sinnlosigkeit, innere Unruhe, Schlafstörungen – häufig mit Früherwachen – Schuldgefühle, Suizidgedanken sowie körperliche Symptome wie dumpfe Kopfschmerzen oder ziehende Rückenschmerzen. Kleinste Verrichtungen erfordern eine große Anstrengung und hinterlassen das Gefühl einer anhaltenden Erschöpfung.
Bei der bipolaren affektiven Störung, auch als manisch-depressive Erkrankung bekannt, wechseln schwere depressive Zustände mit manischen Phasen ab, die durch Antriebssteigerung, geringes Schlafbedürfnis, Größenideen, unsinnige Geldausgaben, aber auch Aggressivität bis hin zu Erregungszuständen gekennzeichnet sind. Bei schweren Depressionen kann es auch zu Wahnvorstellungen kommen, z. B. im Sinne eines Verarmungswahns oder der Vorstellung, an einer unheilbaren körperlichen Erkrankung, z. B. an Krebs oder der Alzheimer-Demenz, zu leiden.
Depressive Erkrankungen - Allgemeine Behandlung
Häufig ist die längerfristige Einnahme antidepressiv wirkender Medikamente erforderlich, um entsprechende Ungleichgewichte im Hirnstoffwechsel auszugleichen. In besonderer Weise haben sich auch psychotherapeutische Maßnahmen bewährt, die z. B. den Abbau dysfunktionaler und depressionsverstärkender Kognitionen und Grundeinstellungen fokussieren. Ein soziales Kompetenztraining kann dazu beitragen, dass die Betroffenen aus chronischen Überforderungssituationen herauskommen und lernen, eigene Bedürfnisse adäquat zu äußern und, wenn möglich, auch zu erfüllen.
Therapeutisch steht bei akuten Zuständen zunächst die Pharmakotherapie im Vordergrund. Entscheidend ist, dass, wenn irgend möglich, eine Vollremission der jeweiligen Krankheitsphase angestrebt wird. Langzeitstudien zeigen, dass die Rezidivneigung durch eine konsequente mehrjährige Einnahme der antidepressiven und/oder phasenprophylaktischen Medikation deutlich reduziert werden kann. Menschen mit einer Neigung zu Depressionen müssen lernen, ein angemessenes Verhältnis von An- und Entspannung, von Arbeit und Freizeit zu finden, um nicht in einen chronischen Erschöpfungszustand zu geraten. In diesem Zusammenhang kann insbesondere ein regelmäßiges körperliches Training in einer Form, die den Betroffenen auch Spaß macht, einen wichtigen Beitrag leisten. Andere Behandlungsmaßnahmen wie Ergo- oder Kunsttherapie können den Heilungsprozess unterstützen.
Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis können sich auf ganz unterschiedliche Weise ankündigen. Häufig fällt den Eltern oder Freunden als erstes eine gewisse Wesensänderung oder ein Rückzug aus bisherigen sozialen Aktivitäten auf. Bei manchen Patienten stehen über Jahre auch depressiv anmutende Symptome im Vordergrund. Andere Patienten wirken innerlich angespannt und unruhig oder berichten über eigenartige Grübeleien. Wieder andere werden zunehmend misstrauisch und fühlen sich verfolgt. Bei vielen Patienten kommt es irgendwann zum Auftreten sogenannter „produktiver Symptome“ wie Halluzinationen (z. B. Stimmenhören) oder Wahnvorstellungen. Manchmal ist es schwer, den Kranken in ihren Gedankengängen zu folgen, das Denken wird „zerfahren“. Schizophrene Psychosen entstehen auf dem Boden einer erblichen Veranlagung oder durch Störungen in der Embryonalentwicklung. Stress und Situationen, die für den Betroffenen schwer zu bewältigen sind, können bei entsprechender neurobiologischer Disposition zum akuten Auftreten psychotischer Symptome führen.
Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis körperliche Erkrankungen, hohen Zigarettenkonsum, unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, eine verminderte kardiopulmonale Leistungsfähigkeit sowie eine im Vergleich zu Gesunden eingeschränkte Lebenserwartung aufweisen. Viele Patienten sind sehr daran interessiert, ungesunde Lebensgewohnheiten zu verändern, bei anderen Patienten kann dies durch motivationsfördernde Maßnahmen erreicht werden.
Psychosen - Therapeutische Ansätze
Häufig sind die Betroffenen krankheitsbedingt nicht in der Lage, ihre Defizite und die dringende Behandlungsbedürftigkeit zu erkennen, sodass ärztliche Hilfe zunächst abgelehnt wird. Unter adäquater neuroleptischer Medikation nimmt bei vielen Patienten innerhalb von Tagen oder Wochen die produktive Symptomatik deutlich ab und die Denk- und Einsichtsfähigkeit bessern sich. Durch die Einführung der atypischen Neuroleptika haben sich die Behandlungsmöglichkeiten weiter verbessert [1, 4]. Der Hauptvorteil dieser Arzneimittel besteht darin, dass sie in therapeutischen Dosen in der Regel keine extrapyramidalen Symptome auslösen. Außerdem treten anders als unter klassischen Neuroleptika nur sehr selten Spätdyskinesien nach längerer Behandlung auf.
Neben der pharmakologischen Behandlung ist eine gute psychotherapeutische Begleitung des Patienten sehr wichtig, insbesondere um ein über den akuten Zustand hinaus währendes Arbeitsbündnis vorzubereiten. Andernfalls könnte es aufgrund schlechter Compliance zu einem baldigen Rezidiv der Krankheitsphase kommen. Psychoedukative Maßnahmen, durch die der Patient und auch die Angehörigen das Grundwissen über die Erkrankung und einen sinnvollen Umgang damit erlernen, gehören heute zum Standard der Psychosebehandlung. Starke Belastungen der familiären Beziehungen, die zu Vorwürfen und Schuldgefühlen geführt haben, müssen aufgearbeitet werden. Nach Abklingen der akuten Erkrankung sollte alles getan werden, um den Patienten die Reintegration in den Beruf zu ermöglichen und soziale Kontakte zu fördern. Vorteilhaft ist eine ausgewogene Alltagsstruktur mit klaren Aufgaben, eindeutigen Absprachen und möglichst entspannten zwischenmenschlichen Beziehungen. Tageskliniken und andere psychosoziale Dienste helfen dem Patienten, wieder mit dem alltäglichen Leben zurechtzukommen.
Neben phasischen Krankheitsverläufen mit zeitlich begrenzten Krankheitsepisoden gibt es auch ungünstige Verläufe mit einem langsamen Voranschreiten der Erkrankung und zunehmenden kognitiven Beeinträchtigungen. Es ist bisher nicht möglich, im Einzelfall den Krankheitsverlauf vorherzusagen. Wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass eine kontinuierliche Einnahme eines wirksamen Medikaments auch langfristig der sicherste Weg ist, Rückfälle oder Verschlechterungen zu verhindern.
Angststörungen - Klinisches Bild
Angststörungen sind mit einer Lebenszeitprävalenz von 15 % vergleichsweise häufig. Im klinischen Kontext ist die Panikstörung von besonderer Relevanz, in einem hohen Prozentsatz besteht gleichzeitig eine Agoraphobie. Kennzeichnend sind Panikattacken, die sowohl in bestimmten Situationen wie auch aus heiterem Himmel auftreten können. Die Betroffenen gehen nach Auftreten der ersten Panikattacken oft davon aus, dass sie unter einer körperlichen Erkrankung leiden, sodass wiederholt verschiedene somatische Untersuchungen durchgeführt werden. Der Häufigkeitsgipfel liegt im jungen Erwachsenenalter, und unbehandelt kann es zur Chronifizierung, zum Missbrauch von Alkohol oder Beruhigungsmitteln und zum Auftreten sekundär bedingter Depressionen kommen.
Die soziale Phobie beginnt oft bereits im Jugendalter und führt zu erheblichen Beeinträchtigungen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Bestimmte soziale Situationen, z. B. der Kontakt zu Vorgesetzten oder zum anderen Geschlecht, sind extrem angstbesetzt und vom Betroffenen ohne effektive therapeutische Maßnahmen nicht zu bewältigen.
Des Weiteren wurde eine generalisierte Angststörung definiert, die durch eine spezifische Form der Sorgen gekennzeichnet ist. Die Betroffenen berichten über eine ängstlich-unruhige Anspannung, die sich über Stunden oder auch den ganzen Tag hinweg erstrecken kann. Dabei kreisen die Sorgen typischerweise um bestimmte Themen, z. B. dass nahen Angehörigen etwas zustoßen könnte, etwa im Straßenverkehr, oder um andere katastrophale Ereignisse, die möglicherweise eintreffen könnten.
Ausgeprägte Angstsymptome und Vermeidungsverhalten kommen darüber hinaus bei der posttraumatischen Belastungsstörung und auch bei der Zwangsstörung vor. Die posttraumatische Belastungsstörung entwickelt sich als Folge eines einschneidenden, „traumatisierenden“ Erlebnisses, das in der Regel mit einer starken Schreckreaktion, Hilflosigkeit und Todesangst einhergegangen ist. Als Folge kommt es häufig zu einer dauerhaft erhöhten inneren Anspannung, Schlafstörungen, Vermeidungsverhalten und charakteristischen Nachhallerinnerungen, bei denen das belastende Ereignis plötzlich wieder lebendig vor Augen steht. Bei der Zwangsstörung handelt es sich um eine chronische, die Lebensqualität stark einschränkende Erkrankung. Hauptsymptome sind wiederkehrende Zwangsgedanken und -handlungen. Unter Zwangsgedanken versteht man Gedanken, innere Bilder oder Impulse, die sich gegen den Willen des Patienten aufdrängen und meistens mit negativen Gefühlen wie Anspannung, Angst oder Ekel verbunden sind. Typischerweise führt das Ausführen der Zwangshandlung zu einer Abnahme der oft durch Zwangsgedanken ausgelösten ängstlichen Anspannung.
Angststörungen - Allgemeine Behandlung
Ein erster und wichtiger Schritt in der Behandlung von Angststörungen besteht darin, den Patienten nach Stellung der richtigen Diagnose über die Art der Erkrankung und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären. Die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie und der medikamentösen Behandlung mit vorrangig Serotoninwiederaufnahmehemmern (SSRI) konnte in zahlreichen Studien belegt werden. In schweren Fällen sollte eine Kombination psychotherapeutischer und medikamentöser Maßnahmen eingesetzt werden. Bei der Zwangsstörung ist bei vielen Patienten die Kombination eines Serotoninwiederaufnahmehemmers (SSRI) oder Clomipramin mit einem atypischen Neuroleptikum erforderlich, wobei auch hier die kognitive Verhaltenstherapie als Methode der 1. Wahl gilt.
Trotz der heute verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten kommt es bei vielen Patienten nur zu einer teilweisen, oft unzureichenden Rückbildung der Symptome. Hier bieten insbesondere Ausdauertraining und andere sporttherapeutische Maßnahmen eine therapeutische Alternative und effektive Ergänzung anderer therapeutischer Maßnahmen, zum Beispiel Expositionsübungen im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie, Entspannungsverfahren und wie schon erwähnt pharmakologische Behandlungen.
Persönlichkeitsstörungen umfassen tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktion auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Dabei findet man bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil beziehen sich auf vielfältige Bereiche von Verhalten und psychischen Funktionen. Häufig gehen sie mit persönlichem Leiden und gestörter sozialer Funktions- und Leistungsfähigkeit einher. Persönlichkeitsstörungen beginnen in der Kindheit oder Adoleszenz und dauern bis ins Erwachsenenalter an. Sie beruhen nicht auf einer anderen psychischen Störung oder einer Hirnerkrankung, obwohl sie anderen Störungen voraus- und mit ihnen einhergehen können.
Die Behandlung erfolgt in unserer Klinik überwiegend auf den Stationen 25 und 10. Letztere verfügt über ein besonderes Behandlungskonzept für Patienten/innen mit einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung. Bei dieser Störung besteht eine deutliche Tendenz, impulsiv zu handeln - ohne in ausreichender Weise die Konsequenzen zu bedenken. Die Stimmung ist sehr wechselhaft, Ausbrüche intensiven Ärgers führen zu negativen Folgen in den persönlichen Beziehungen. Oft sind das eigene Selbstbild, Ziele und innere Präferenzen unklar und wechselnd. Meist besteht ein chronisches Gefühl innerer Leere, es kann auch - vor allem im Zusammenhang mit früheren Traumatisierungen – zu dissoziativen Zuständen („Aussetzern“) kommen. Die Neigung zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen kann zu wiederholtem emotionalen Krisen führen, auch Suizidversuche und selbstschädigenden Handlungen gehören zum Störungsbild.
Mit den oben genannten Krankheitsbildern bestehen sehr große Erfahrungen. Darüber hinaus behandeln wir auch Patienten in akuten Lebenskrisen, mit unklaren Schmerzsyndromen und Schlafstörungen.
Unsere Stationen
Die Station 3 ist eine geschützte Station mit 24 Behandlungsplätzen, hier können rund um die Uhr Patienten mit sehr akuter Symptomatik und Suizidalität aufgenommen und versorgt werden. Auch Aufnahmen durch das Gericht nach PsychKG aus unserem Versorgungsgebiet und durch Betreuer nach BGB sind jederzeit möglich.
Im Rahmen eines multimodalen Behandlungskonzeptes mit vorwiegend medikamentöser Behandlung, stützenden Gesprächen und Begleittherapien (z. B. Ergotherapie und Sporttherapie) sehen wir es als unsere Aufgabe, unsere Patienten so schnell wie möglich zu stabilisieren, um die weitere Behandlung auf unseren störungsspezifischen offenen Stationen oder in der Tagesklinik fortzusetzen.
Jeder Patient bekommt bei Aufnahme auf unserer Station eine Bezugspflegekraft und einen Bezugstherapeuten (Arzt) zugeteilt, sodass während der kompletten Behandlung eine Kontinuität gewährleistet ist.
Die Station hat aktuell 18 Planstellen für die Pflege und ist mit einem Oberarzt und zwei Stationsärzten besetzt.
Stationstelefon: (0385) 520-32 56
Die Station 5 ist eine offen geführte psychiatrische Akutstation. Das multiprofessionelle Behandlungsteam bietet sowohl Kriseninterventionen als auch umfangreichere Behandlungen zahlreicher seelischer Erkrankungen an.
Spezielle Pharmakotherapien, Elektrokonvulsionstherapie sowie evidenzbasierte psychotherapeutische Behandlungsmodule kommen in der Behandlung der vielfältigen Krankheitsbilder zum Tragen.
Gestärkt durch das pflegerische Betreuungskonzept und den spezifischen Komplementärtherapien Sport- und Bewegungstherapie, Ergotherapie, der tiergestützten Therapie und Musiktherapie bieten wir ein ganzheitliches und multimodales Behandlungskonzept an. Die individuelle Behandlung stellen wir störungsspezifisch und prozeßbasiert entlang der Möglichkeiten des Patienten und den Zielen in der Behandlung aus diesem umfangreichen Behandlungsprogramm zusammen.
Nach einer Stabilisierungsphase wird Hauptaugenmerk des stationären Aufenthaltes auf die Erarbeitung eines Modells der individuellen Basisstörung gelegt. Hierbei kommen die klassische psychiatrisch-klinische Diagnostik und ausführliche neuropsychiatrische Untersuchungen (cMRT, EEG, Liquor) sowie Prozeßanalysen zu Problem und Lösungen zur Anwendung. Therapeutische Ziele sind neben Reduktion der akuten Beschwerden dann auch die verbesserte Selbstbefähigung unserer Patientinnen und Patienten, Funktionsverbesserung im Alltag zur Erhöhung der Lebensqualität und nachhaltige Stärkung der Eigenverantwortung, ggf. auch für zukünftige intensivere Therapien.
Zudem haben wir eine langjährige Expertise in der Diagnostik noch ungeklärter neuropsychiatrischer Störungsbilder, die mit psychischen oder sozialen Problemen einhergehen (Immun-Enzephalopathien, ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen). Als weitere Besonderheiten gelten die Integration der peer-Arbeit durch die Genesungsbegleiterin und die Unterstützung durch den Sozialarbeiter.
Für Aufnahmen bitten wir um telephonische Voranmeldung durch einen ärztlichen Kollegen, der die Indikation für eine stationäre Behandlung stellt. Telefon der Station: 0385 – 520 3218
Überregionale Bedeutung haben die auf der Station 5 angebotene Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (nur während eines mehrtägigen stationären Aufenthaltes) sowie das Zentrum für Sportpsychiatrie und Sportpsychotherapie, in dem sich Leistungssportlerinnen und Leistungssportler individuell von unserem erfahrenen und DGSPP-zertifizierten Team bei seelischen Krisen und Erkrankungen untersuchen und behandeln lassen können.
Anmeldungen bzw. Nachfragen können Sie für beide Schwerpunkte direkt an den Oberarzt der Station Dr. med. K. Winter (klaas.winter@helios-gesundheit.de) stellen.
Die Station 10 (DBT-Station) arbeitet auf der Grundlage der Dialektisch-Behavioralen Therapie nach Marsha Linehan und verfügt über 20 Behandlungsplätze.
Die Station ist besonders geeignet für Menschen, die u.a. Probleme damit haben, intensive und wechselhafte Gefühle zu regulieren und bestimmte Handlungsimpulse zu kontrollieren. Dies trifft zum Beispiel für Patienten/innen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zu, aber auch verwandte Störungsbilder können hier behandelt werden. Nach ausführlicher Diagnostik werden individuelle Therapieziele festgelegt und angestrebt.
Die Therapie umfasst:
- psychotherapeutische Einzelgespräche
- Fertigkeitentraining in der Gruppe (innere Achtsamkeit, Umgang mit Gefühlen, Stresstoleranz, Selbstwert)
- soziales Kompetenztraining
- Coaching in Krisen durch das Pflegepersonal
- Pflegegespräche
- Sport
- Reittherapie
- Ergotherapie
- Erlernen von Entspannungsverfahren
- Genusstherapie
- Gruppenunternehmungen
- therapeutische Oberarztvisiten
- externe Therapietage zum Tranfer des in der Therapie Erlernten ins gewohnte Umfeld
- Paar- oder Angehörigengespräche
Stationstelefon: (0385) 520-33 20
Die Station 24 ist als Spezialstation für Patienten mit verschiedenen depressiven Erkrankungen über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Die Station verfügt über insgesamt 26 Betten. Das Therapiekonzept beinhaltet eine mehrdimensionale Behandlungsstrategie, bestehend aus einer leitlinienorientierten Pharmakotherapie, einem breitgefächerten komplementärtherapeutischen Angebot sowie einer vor allem durch die kognitive Verhaltenstherapie geprägten Psychotherapie (incl. Training sozialer Kompetenzen) und einer depressionsspezifischen Psychoedukation.
Grundlage der Arbeit des multiprofessionellen Teams ist ein psychotherapeutisches Basisverhalten, das eine empathische und authentische Begegnung mit dem an einer depressiven Störung leidenden Menschen ermöglicht, individuelle Ressourcen erschließt, ihn durch Entwicklung neuer Perspektiven ermutigt und begründete Hoffnungen vermittelt. Dem multiprofessionellen Team gehören neben einen erfahrenen Pflegeteam ein Oberarzt, zwei Psychologen, ein Stationsarzt, eine Sozialarbeiterin, eine Ergotherapeutin, eine Sport- und Bewegungstherapeutin, eine Reittherapeutin und eine Musiktherapeutin an.
Stationstelefon: (0385) 520-32 70
Die Station 25 verfügt mit ihrem störungs- und individuumsspezifischen Therapieangebot über insgesamt 15 Betten.
Diagnostischer und therapeutischer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen bzw. -akzentuierungen, aber auch gravierenden Beeinträchtigungen im Rahmen psychosozialer Konfliktlagen.
Das Konzept beinhaltet neben Einzelgesprächen auch eine Gruppenpsychotherapie und orientiert sich überwiegend an tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie, wobei im Sinne eines schulenübergreifenden Arbeitens auch Elemente der klientenzentrierten Psychotherapie nach ROGERS und der kognitiven Verhaltenstherapie einfließen.
Zusätzlich wird eine spezifische Therapie für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung angeboten.
Besondere Bedeutung hat auch die kommunikative Bewegungstherapie, die gemeinsam mit anderen komplementären Therapien (Ergo- und Musiktherapie, tiergestützte Therapie) zur Anwendung kommt.
Stationstelefon: (0385) 520-32 72
Die Station 26 (offene Psychosestation) ist konzipiert für Patienten zwischen 18-65 Jahren, die einer vollstationären psychatrisch-psychotherapeutischen Behandlung bedürfen.
Behandelt werden u.a. folgende Erkrankungen: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen, schizoaffektive Störungen, Patienten mit Mehrfacherkrankungen, sofern psychotische Symptome eine wesentliche Beeinträchtigung darstellen.
Die Station verfügt über 17 Betten und einen großen Garten unmitten eines schönen Landschaftsparks.
Auf der Station kann eine Ausschlussdiagnostik bei Erstmanifestation einer psychotischen Erkrankung erfolgen (u.a. MRT, LP, EEG, EKG, Labor), ferner eine Stabilisierung bei Exacerbation einer bekannten Psychose mit Neueinstellung oder Optimierung der antipsychotischen medikamentösen Behandlung und bei Bedarf eine sozialarbeiterische Beratung bzw. Bahnung sinnvoller poststationärer Maßnahmen (wie z.B. Tagesklinik, Tagesstätte, RPK, therapeutische WG, Wohnheim).
Im Vordergrund der stationären Behandlung stehen einzeltherapeutische Gespräche und die Optimierung der Medikation und die klare Strukturvorgabe durch das stationäre Setting mit seiner therapeutsich gewünschten Reizabschirmung, ferner die Durchführung einer Psychoedukation, unterstützend werden Komplementärtherapien wie Ergo-, Arbeits-, Sport-, Musik- und Reittherapie angeboten.
Ein besonderes Anliegen der Station ist das Training alltagsrelevanter Fähigkeiten sowie die Einbindung von Angehörigen über Familiengespräche.
Stationstelefon: (0385) 520-34 26
Unsere Einrichtungen
Die Geburt eines Kindes ist für eine junge Familie eine neue Herausforderung. Sie kann zu Problemen bzw. Belastungen innerhalb der Familie führen. Es gibt Kinder, die besondere Bedürfnisse oder Verhaltensauffälligkeiten haben. Diese können den Bindungs- und Beziehungsaufbau erschweren.
Auch können psychische Erkrankungen der Eltern Schwierigkeiten in der kindlichen Entwicklung zur Folge haben. Die Eltern-Kleinkind-Station ermöglicht eine Behandlung psychischer Erkrankungen von Eltern sowie Kindern in einem multiprofessionellen Team. Ein Ziel ist unter anderem, die Bindung zwischen Eltern und Kind zu stärken und positive Beziehungserfahrungen zu erleben.
Helios Kliniken Schwerin
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Eltern-Kleinkind-Station
Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin
Telefon: (0385) 520-3051
Welche Patienten behandeln wir?
Auf der Eltern-Kleinkind-Station können Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern im Alter von 0-6 Jahren behandelt werden.
Das Spektrum umfasst:
- Behandlung von Müttern / Vätern mit behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen
- Behandlung von Säuglingen mit Regulationsstörungen ("Schreibabys", Gedeihstörungen, Fütterstörungen etc ...) und Kleinkindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Somatische Erkrankungen, die Gedeih- oder Fütterstörungen verursachen, sollten im Vorfeld ausgeschlossen sein.
- Nachbehandlung bzw. Nachbetreuung von Risikogruppen (z.B. Frühgeburt) mit Entwicklungsstörungen und besonderen Bedürfnissen
Was bieten wir an?
- Psychiatrische und psychologische Diagnostik sowie Behandlung der Eltern
- Entwicklungsdiagnostik und Behandlung der Kinder
- Eltern-Kind-Therapie (Interaktionsbeobachtung, Intervention - auch videogestützt)
- Anleitung der Eltern im Umgang mit dem Kind
- Familientherapie
- Kindergruppen und Eltern-Kind-Gruppen
- Bezugspflege
- Sozialpädagogische Beratung und Begleitung (Organisation ergänzender Unterstützungen)
- nach Bedarf: soziales Kompetenztraining, Ergotherapie, physiotherapeutische Angebote, Ernährungsberatung bzw. Stillberatung, Babymassage, Babyschwimmen
Die Außenstelle der Tagesklinik in Ludwigslust existiert seit 2005 und verfügt aktuell über 16 Behandlungsplätze. Zusätzlich haben wir seit 2020 eine Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) eröffnet.
Tagesklinik Ludwigslust
Schlossstraße 16
19288 Ludwigslust
Telefon: (03874) 250 77 0
Fax: (03874) 250 77 20
psychiatrie-tagesklinik-lwl.schwerin@helios-gesundheit.de
Leistungsspektrum
- teilstationäre Behandlung von Patienten mit Psychosen, affektiven Störungen, Angsterkrankungen und bestimmten Formen von Persönlichkeitsstörungen
- moderne, effiziente Behandlungsform mit hoher Akzeptanz bei Patienten und Angehörigen
- Vermeidung oder Verkürzung einer vollstationären Krankenhausbehandlung
- Intensivierung einer ambulanten Behandlung bei Therapieresistenz
- allgemein-psychiatrische Tagesklinik mit Behandlung an 5 Tagen pro Woche, jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr
- Erhalt der familiären und sozialen Bindungen durch Verbleib im Alltagsumfeld bei gleichzeitiger Teilnahme an einem intensiven psychiatrischen Therapieprogramm
Seit Eröffnung der PIA kommen folgende Angebote hinzu:
- ambulante Behandlungsmöglichkeit in der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) insbesondere für schwere, chronische psychische Erkrankungen
- Indikationsstellung für stationäre oder teilstationäre Behandlung (Vorgespräch Tagesklinik)
- Krisenintervention
Die Außenstelle der Tagesklinik in Sternberg existiert seit Mai 2013 und bietet derzeit Behandlungsplätze für 12 Patienten.
Die Tagesklinik verfügt über ein multiprofessionelles Therapeutenteam, bestehend aus einer Fachärztin, einer Diplom-Psychologin, zwei Fachpflegekräften, einer Ergotherapeutin und einer Sozialpädagogin.
Tagesklinik Sternberg
Vor dem Pastiner Tor 6- 8
19406 Sternberg
Telefon: (03847) 435 98 82
Leistungsspektrum
- teilstationäre Behandlung von Patienten mit Psychosen, affektiven Störungen, Angsterkrankungen und bestimmten Formen von Persönlichkeitsstörungen
- moderne, effiziente Behandlungsform mit hoher Akzeptanz bei Patienten und Angehörigen
- Vermeidung oder Verkürzung einer vollstationären Krankenhausbehandlung
- Intensivierung einer ambulanten Behandlung bei Therapieresistenz
- allgemein-psychiatrische Tagesklinik mit Behandlung an 5 Tagen pro Woche, jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr
- Erhalt der familiären und sozialen Bindungen durch Verbleib im Alltagsumfeld bei gleichzeitiger Teilnahme an einem intensiven psychiatrischen Therapieprogramm
Die Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Schwerin besteht bereits seit mehr als 10 Jahren und befindet sich auf dem Gelände der Carl-Friedrich-Flemming-Klinik.
Tagesklinik Schwerin
Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin
Telefon: (0385) 520-3127
Leistungsspektrum
- teilstationäre Behandlung von Patienten mit Psychosen, affektiven Störungen, Angsterkrankungen und bestimmten Formen von Persönlichkeitsstörungen
- moderne, effiziente Behandlungsform mit hoher Akzeptanz bei Patienten und Angehörigen
- Vermeidung oder Verkürzung einer vollstationären Krankenhausbehandlung · Intensivierung einer ambulanten Behandlung bei Therapieresistenz
- allgemein-psychiatrische Tagesklinik mit Behandlung an 5 Tagen pro Woche, jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr
- Erhalt der familiären und sozialen Bindungen durch Verbleib im Alltagsumfeld bei gleichzeitiger Teilnahme an einem intensiven psychiatrischen Therapieprogramm
Besonderheiten
- enge Kooperation mit komplementären Einrichtungen innerhalb des regionalen Versorgungsnetzes
- innerhalb des Psychiatrischen Fachkrankenhauses inhaltliche und personelle Verzahnung mit der Psychiatrischen Institutsambulanz
- auch niederschwelliger Zugang zur Behandlung möglich, ansonsten auf Überweisung durch Psychiater oder Hausarzt
- Teilnahme an Modellprojekten zur integrierten Versorgung von Patienten mit Psychosen oder affektiven Störungen
- indikationsspezifisch aufsuchende Tätigkeit