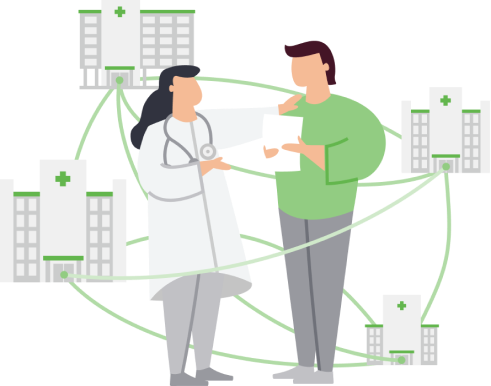Was sind die Ursachen für schwarzen Hautkrebs?
Das maligne Melanom wird auch schwarzer Hautkrebs genannt. Es ist ein Tumor, der aus den Melanozyten entsteht. Das sind Zellen in der Oberhaut, die für die Färbung der Haut (Pigmentierung) verantwortlich sind.
Ein Melanom kann sich auf gesunder Haut entwickeln, sowie unter den Nägeln, an Schleimhäuten oder in den Augen. Es entsteht sowohl aus bereits bestehenden Hautveränderungen, wie dem Muttermal oder dem Leberfleck, als auch auf vorher unveränderter Haut.
Eine zu hohe UV-Belastung, also intensive Sonneneinstrahlung, spielt die zentrale Rolle für die Entstehung von schwarzem Hautkrebs. Sonnenbrände, vor allem in der Kindheit, verändern die Zellen und führen Jahre später zur Entwicklung eines Tumors.
Ein heller Hauttyp (Hauttyp 1 und Hauttyp 2) sowie genetische Veranlagungen haben ebenfalls einen Einfluss auf die Entstehung eines Melanoms. Aber auch Erwachsene und Menschen mit einem dunklen Hauttyp (Hauttyp 3 und Hauttyp 4) sollten intensive UV-Strahlung vermeiden.
Dr. med. Kerstin Lommel, Chefärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie im Helios Klinikum Berlin-Buch erklärt, welche Risikofaktoren es für schwarzen Hautkrebs gibt.
UV-Belastung
Wiederholt haben Studien gezeigt, dass Menschen, die häufig ungeschützt einer hohen UV-Strahlung ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs haben [1]. Die intensive Sonneneinstrahlung gilt als wichtigster Risikofaktor für ein malignes Melanom.
Gestützt wird diese Beobachtung durch die Verteilung der Melanome: So entstehen nur rund sechs Prozent von ihnen auf Körperstellen, die in der Regel vor Sonne geschützt sind (Unterbauch, Schleimhäute, Genitalbereich). Circa 94 Prozent der bösartigen Tumore sind hingegen auf häufig ungeschützten Hautflächen zu finden (Gesicht und Kopf, Hals, Hand, Fuß, Beine oder Rücken).
Heller Hauttyp
Menschen mit den helleren und empfindlicheren Hauttypen 1 und 2 bekommen bei ungeschütztem Aufenthalt in der Sonne schneller einen Sonnenbrand, als Menschen mit den dunkleren Hauttypen 3 und 4. Jeder Sonnenbrand wiederum schädigt die Haut und kann zu DNA-Schäden in den Hautzellen führen – damit steigt auch das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.
Das Leitlinienprogramm der medizinischen Fachgesellschaften listet folgende Hauttypen mit ihren jeweiligen Eigenschaften:
Je nach Hauttyp unterscheidet sich die Eigenschutzzeit der Haut bei intensiver Sonneneinstrahlung:
Pigmentmale
Es wird vermutet, dass die Anzahl der im Alter von null bis sechsJahren durch UV-Strahlung erworbenen Muttermale beziehungsweise Leberflecke („Nävi“) ein höheres Risiko für die spätere Entstehung von schwarzem Hautkrebs darstellen [2]. Zwar entsteht nicht jedes Melanom aus einem Leberfleck, jedoch erhöht eine große Zahl an Leberflecken das Risiko einer Erkrankung – auch auf unveränderter Haut.
Neben den erworbenen Pigmentmalen zählen auch die bereits bei Geburt vorhandenen Leberflecke („kongenitale Nävi“) zu den möglichen Ursachen für ein Melanom. Dabei gilt: Je größer der Nävi ist, desto höher ist das Entartungsrisiko.
Vorhergehende Erkrankung an schwarzem Hautkrebs
Menschen, die schon einmal am malignen Melanom erkrankt waren, haben ein 8,5-fach erhöhtes relatives Risiko, nochmals daran zu erkranken [2]. Aus diesem Grund sind regelmäßige Untersuchungen der Haut bei Melanom-Patient:innen besonders wichtig.
Familiäre Vorbelastung
Das Melanom kann gehäuft in Familien auftreten und auf eine genetische Veranlagung zurückgehen. Statistiken zeigen, dass bei fünf bis zwölf Prozent der Patient:innen ein Verwandter 1. Grades (Mutter, Vater, Geschwister) ebenfalls an Hautkrebs erkrankte.
Dabei belegen Genuntersuchungen, dass das Gen p16INK4A in 25 bis 40 Prozent der Fälle von familiärem schwarzen Hautkrebs mutiert ist. Es wird angenommen, dass p16INK4A das Wachstum von Muttermalen kontrolliert. Mutiert es, kann es zu einem ungebremsten Zellwachstum und damit zur Entstehung von bösartigen Tumoren kommen [2].
Genetische Mutation
Genetische Mutationen können auch unabhängig von einer familiären Häufung auftreten. Das beim schwarzen Hautkrebs am häufigsten mutierte Krebs-Gen trägt den Namen B-RAF. In rund 50 Prozent der Patient:innen mit malignem Melanom kann bei diesem Gen eine Mutation nachgewiesen werden [3].
Es ist bekannt, dass B-RAF an den Signalwegen für ein normales Zellwachstum beteiligt ist. Mutiert das Gen, können diese Signalwege und damit das kontrollierte Zellwachstum gestört werden. Die Folge kann ein ungehemmtes Zellwachstum sein – Hautkrebs entsteht.
Schwarzer Hautkrebs im Alter
Das mittlere Erkrankungsalter für ein malignes Melanom beträgt bei Frauen 60 Jahre und bei Männern 68 Jahre. Statistisch gesehen ist schwarzer Hautkrebs also eine Krankheit, die vor allem ältere Menschen betrifft. Durch ein verändertes Freizeitverhalten oder das Vorliegen von bestimmten Risikofaktoren können jedoch grundsätzlich auch jüngere Menschen erkranken. Die Zahl der Neuerkrankungen in jüngeren Altersgruppen hat de facto in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen.
Folgendes Säulendiagramm zeigt die Erkrankungsrate von Männern und Frauen der verschiedenen Altersgruppen im Jahr 2016:
Was bedeutet „erhöhtes Hautkrebsrisiko“?
Um zu klären, ob das individuelle Hautkrebsrisiko erhöht ist, nutzen Ärzt:innen das sogenannte „Relative Risiko“ (RR). Dabei geht es um die Frage, wie viele von 100 Menschen am malignen Melanom erkranken, wenn bei ihnen ein bestimmter Risikofaktor vorliegt – im Vergleich zur Zahl der Erkrankten pro 100 Menschen ohne den gleichen Risikofaktor.
Wie stark die verschiedenen Faktoren das individuelle Erkrankungsrisiko erhöhen, zeigt diese Tabelle [2].
Ist schwarzer Hautkrebs tödlich?
Das maligne Melanom bildet deutlich häufiger und auch schneller Metastasen als der weiße Hautkrebs. Eine Früherkennung des Tumors und seine rasche Therapie sind daher äußerst wichtig.
Wird schwarzer Hautkrebs früh erkannt, können die Patient:innen in den meisten Fällen komplett geheilt werden. Statistisch gesehen leben 93 von 100 betroffene Frauen noch fünf Jahre nach Diagnose, bei den Männer sind es 91 von 100 [1].
Eine späte Diagnose senkt die Heilungschancen. Für das fortgeschrittene Stadium, in dem der Tumor bereits Metastasen gebildet hat, stehen heute jedoch eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die die Heilungschancen beziehungsweise die Überlebenszeit erheblich verbessert haben.
Folgendes Diagramm zeigt, wie viele Patient:innen fünf Jahre nach Diagnose noch leben („Fünf-Jahres-Überlebensrate“):
Hinweis: Die relative Überlebensrate gibt an, wie viele Menschen mit hellem Hauttyp zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (entspricht 100 Prozent) noch leben.
Schwarzem Hautkrebs vorbeugen
Eine dauerhafte oder auch saisonal zu hohe Belastung mit UV-Strahlen ist der Hauptrisikofaktor für schwarzen Hautkrebs. Die Prävention setzt daher genau hier an: Übermäßige Sonnenexposition und Sonnenbrände sollten in jedem Alter konsequent vermieden werden.
Außerdem sollte auf den ausreichenden Schutz von Haut und Augen durch Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel geachtet werden.
Übermäßige Sonnenexposition vermeiden
Um bei entsprechender Wetterlage eine gefährliche Sonnenexposition zu verhindern und somit der Entstehung von Hautkrebs vorzubeugen, werden folgende Maßnahmen empfohlen [1]:
- so kurz wie möglich im Freien aufhalten
- Mittagssonne meiden
- beim Aufenthalt in der Sonne die Eigenschutzzeit der Haut berücksichtigen
- wenn möglich im Schatten bleiben
- Aktivitäten in den Morgen oder Abend verlegen
- die Haut im Frühling langsam an die Sonne gewöhnen
- Sonnenbrand unbedingt vermeiden
Die Haut durch Kleidung schützen
Wer sich bei hoher UV-Strahlung im Freien aufhält, sollte die Haut und auch den Kopf durch geeignete Kleidung und Kopfbedeckung abschirmen. Ein konventionelles T-Shirt bietet der Haut beispielsweise Schutz in Höhe des UV-Schutzfaktors (UPF) 20. Spezielle UV-Kleidung kann einen noch höheren Schutzfaktor bieten. Der UV-Schutzfaktor ist vergleichbar mit dem Lichtschutzfaktor (LSF) von Sonnencremes.
Wichtig: Sehr dünne Stoffe können einen geringeren UPF aufweisen. Die S3-Leitlinie empfiehlt dann, ein weiteres Kleidungsstück zu ergänzen.
Werden zwei Kleidungsstücke aus normaler Stoffstärke übereinander getragen, so multipliziert sich der UPF. So ergeben zwei übereinander getragene T-Shirts mit einem UPF von jeweils 20 einen UPF von 400.
Die Augen sollten bei starker Sonneneinstrahlung durch das Tragen einer Sonnenbrille geschützt werden. Wichtig: Die Sonnenbrille sollte der europäischen Norm EN 1836 entsprechen und ausreichend abdunkeln. Wie stark die Brille abdunkelt, gibt die Blendungskategorie an. Die S3-Leitlinie empfiehlt die Kategorien 2 und 3 für den Alltag, die Kategorie 4 hingegen für extreme Umgebungen wie Gletscher.
Hinweis: Auch Sonnenschirme sind UV-durchlässig und auch der Farbton ist von Bedeutung. So sind hellere Farben UV-durchlässiger als dunklere.