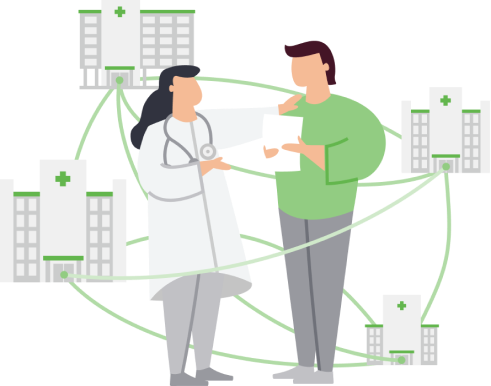Erster Schritt: Anschluss-Reha
Ist die Therapie des Melanoms erfolgreich abgeschlossen, folgt für die Patient:innen die Phase der Rehabilitation und Nachsorge. Ein erster Schritt ist die Anschlussrehabilitation, die in der Regel in einer Reha-Klinik, optimal mit dermatologischer Fachabteilung, stattfindet.
Daneben sind regelmäßige Arzttermine wichtig, um einen eventuell auftretenden Rückfall, das Rezidiv, sowie Nebenwirkungen oder späte Folgen der Behandlung rasch zu erkennen und eine wirksame Therapie einleiten zu können.
Wann und warum sollte ich zur Reha?
Beim Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung wird zwischen einer stationären onkologischen Reha und einer Anschlussrehabilitation (AHB, früher: Anschlussheilbehandlung) nach beendeter Krankenhausbehandlung unterschieden.
Trägt die Rentenversicherung Bund die Kosten der Reha, muss die AHB innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende der Behandlung im Krankenhaus oder der Strahlentherapie begonnen werden. Der Antrag sollte frühzeitig bei der Rentenversicherung eingereicht werden.
Im Gegensatz zur Anschlussrehabilitation können die Patient:innen eine stationäre-onkologische Rehabilitation bis zu einem Jahr nach Abschluss der Akut-Behandlung beginnen. Beide Reha-Maßnahmen dauern drei Wochen und erfolgen in der Regel stationär in einer Reha-Klinik. Nur in Ausnahmefällen finden sie teilstationär beziehungsweise ambulant in Wohnortnähe statt.
Was passiert in der Reha?
Durch die Therapien in einer Reha-Klinik sollen Melanom-Patient:innen für die Rückkehr in ihren Alltag gestärkt werden. Der Hautkrebs und seine Therapie haben das Leben der Betroffenen auf den Kopf gestellt und viel Kraft gekostet. Nun geht es darum, zur Ruhe zu kommen und Hilfestellungen für die neue Normalität nach der Krebserkrankung zu erhalten. Übliche Angebote sind daher Maßnahmen zur Krankheitsverarbeitung oder auch Beratungen für den beruflichen Wiedereinstieg.
Nach einer Hautkrebserkrankung können verschiedene medizinische Probleme auftreten, bei deren Bewältigung die Patient:innen durch entsprechende Fachärzt:innen oder Psychoonkolog:innen unterstützt werden sollten. In Reha-Kliniken werden häufig folgende Beschwerden behandelt:
- Chemotherapie-bedingte Nebenwirkungen
- Krankheits- oder therapiebedingtes Erschöpfungsgefühl (Fatigue-Syndrom)
- Konzentrations- und Schlafstörungen
- Ängste oder Depressionen
- Wundheilungsstörungen
Wichtige berufliche Beratung
Die Klärung der beruflichen Situation während der Rehabilitation ist ein oft unterschätztes Thema. Während der Rehabilitation werden wichtige beruflich relevante Belastungspunkte und Lösungsansätze besprochen. Es gibt unterstützende Therapien, Schulungen und Beratungen in Hinblick auf den Beruf. Der konkrete berufliche Wiedereinstieg oder eine Erwerbsminderungsrente werden Thema sein.
Die Patient:innen werden ihre berufliche Situation und Belastbarkeit durch die Rehabilitation besser einschätzen können. Auch die Ärztin oder der Arzt schätzt die berufliche Belastbarkeit ein. Dies dient der Rentenversicherung als wichtige Entscheidungsgrundlage.
Besonderheiten einer stationären Reha
Die Verarbeitung und Bewältigung eines malignen Melanoms erfordert häufig Kraft und auch wichtige Entscheidungen. Die Zeit und Ruhe während der Rehabilitation nutzen viele Patient:innen, um ihre Krankheits- und Lebenssituation neu zu überdenken.
Sie spüren oft wieder zunehmende körperliche und seelische Kräfte und können ihre eigenen Möglichkeiten, aber auch die weiter bestehenden Grenzen mit Blick auf die Zukunft besser einschätzen. Das Gespräch mit erfahrenen Ärzt:innen, Psycholog:innen, Therapeut:innen und Pflegekräften bietet dafür einen sinnvollen Rahmen. Aber auch das besondere Umfeld einer Klinik spielt eine große Rolle und kann diesen Prozess der Krankheitsbewältigung fördern.
Spaziergänge in der Natur, das Zusammensitzen abends im kleinen Kreis oder auch eine Kunstwerkstatt sind wichtige Gelegenheiten, um mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Der Austausch untereinander ist dabei von unschätzbarem Wert.
Die Wahl einer Klinik mit dermatologischer Fachabteilung ist daher auch dafür wichtig, um in der Reha auf Patient:innen zu treffen, die ebenfalls am malignen Melanom erkrankt waren. Viele Hautkrebs-Patient:innen sind positiv überrascht, wie hilfreich diese Kontakte für die Seele, aber auch für Alltagsfragen im Umgang mit der Erkrankung sind („aktives Coping“) [1]. Eine stationäre Rehabilitation stellt somit auch eine wichtige Chance zur Krankheitsbewältigung dar.
Wer übernimmt die Kosten für die Reha?
Die Kosten für den Reha-Aufenthalt werden bei gesetzlich versicherten Patient:innen von den gesetzlichen Krankenkassen oder der gesetzlichen Rentenversicherung übernommen. Privatversicherte Patient:innen müssen die Kostenübernahme mit ihrer Versicherung prüfen.
Wichtig: In der Regel wird für die Reha eine Zuzahlung fällig. Diese beträgt zehn Euro pro Tag und ist privat zu tragen.
An wen kann ich mich wenden?
Der Antrag für die Rehabilitation nach der Behandlung eines malignen Melanoms sollte bei der Krankenkasse gestellt werden. Falls erforderlich, wird er von dort an einen anderen zuständigen Kostenträger weitergeleitet. Erfolgt die Reha in Form einer Anschlussrehabilitation, stellt der Sozialdienst des behandelnden Krankenhauses den Antrag.
Nachsorge beim malignen Melanom
Zwischen den regelmäßigen Vorstellungen in einer hautärztlichen Praxis wird eine ebenso regelmäßige Selbstuntersuchung des gesamten Körpers empfohlen.
Wichtig sind:
- die Untersuchung der im Abflussgebiet des Melanoms liegenden Lymphknoten (zum Beispiel bei einem Melanom am Unterschenkel die Lymphknoten in der Kniekehle und Leiste)
- die Untersuchung der Narben im Bereich des entfernten Tumors sowie gegebenenfalls im Bereich der Wächterlymphknoten-Entfernung
Auf folgende Punkte sollte dabei geachtet werden:
- Vergrößerung oder Verhärtung der Lymphknoten
- Knoten im Narbenbereich sowohl unter der Haut als auch neue hautfarbene oder pigmentierte Knoten an der Haut
- Muttermale, die sich beispielsweise wie folgt ändern:
- Änderung der Farbe
- Auftreten einer unregelmäßigen Abgrenzung
- Vergrößerung/Dickerwerden der Muttermale
- Auftreten von Blutungen, Juckreiz und nässenden Arealen im Bereich eines Muttermals
- sich zurückbildende Muttermale
- Auftreten eines roten oder weißen im Bereiches eines Muttermals
Alle genannten Veränderungen sollten zeitnah einer Hautärztin oder einem Hautarzt vorgestellt werden.
Die Nachuntersuchungen in einer hautärztlichen Praxis erfolgen in unterschiedlichen Zeitintervallen und je nach Stadium des Tumors über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Hierbei werden die gesamte Haut und die Lymphknotenstationen untersucht. In höheren Tumorstadien werden ergänzend eine Ultraschalluntersuchung der Lymphknoten und Computertomografien (CT), Magnetresonanztomografien (MRT) oder ein PET-CT durchgeführt. Die Positronen-Emissions-Tomografie, kurz PET, ist ein spezielles Untersuchungsverfahren der Nuklearmedizin, die mit einem CT kombiniert wird.
Zudem wird ein Tumormarker (S100B) bestimmt.
Die Patientenleitlinie des Leitlinienprogramms Onkologie empfiehlt je nach Tumorstadium folgende Untersuchungen und Zeiträume [2]: