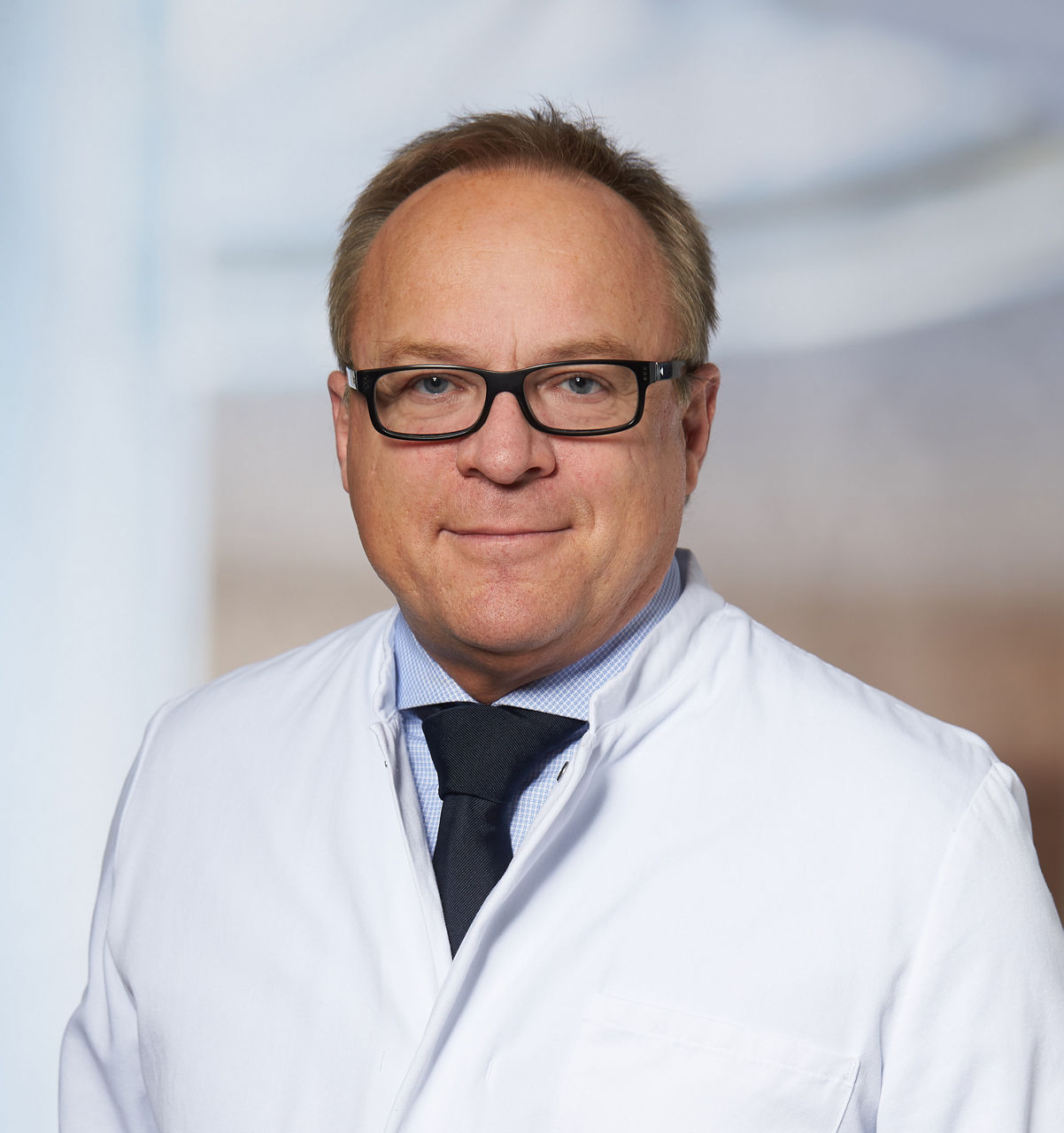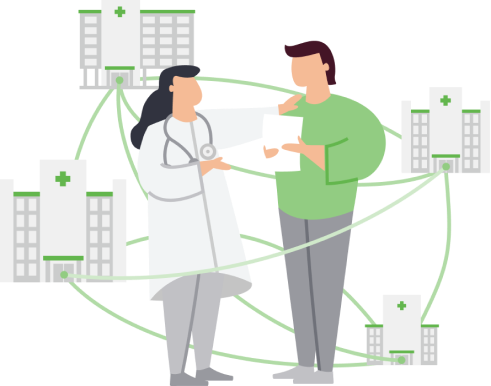Chemotherapie: Was versteht man darunter?
„Unter einer Chemotherapie versteht man in der Krebsmedizin die medikamentöse Behandlung von Krebszellen mit Zytostatika. Diese greifen in den Vermehrungszyklus von Krebszellen ein und hemmen das Tumorwachstum“, so Prof. (SHB) Dirk Hempel, Chefarzt Onkologie am Helios Amper-Klinikum Dachau.
Krebszellen haben eine hohe Teilungsrate und sind daher besonders anfällig für Zytostatika. Ziel der Chemotherapie ist es, das Tumorwachstum zu bremsen oder ganz zu stoppen.
Wie wirkt die Chemotherapie?
Während lokale Therapiemaßnahmen, wie eine Operation oder Strahlentherapie, nur auf Teilbereiche im Körper wirken, ist die Wirkung von Zytostatika relativ unspezifisch und gegen alle Zellen im gesamten Körper gerichtet. Insbesondere Zellen, die sich häufig teilen, sind davon betroffen.
Der Effekt der Zytostatika richtet sich daher auch gegen andere, gesunde Zelltypen, die sich rasch vermehren, etwa im Knochenmark, den Haaren, der Haut oder den Schleimhäuten. Daraus ergibt sich die Hauptursache für bekannte Nebenwirkungen, wie Haarausfall oder Entzündungen in der Mundschleimhaut. Zytostatika unterscheiden nicht zwischen bösartigen und gesunden Zellen, sondern greifen alle an.
Kurative oder palliative Chemotherapie
Darmkrebs lässt sich in vier Krankheitsstadien einordnen. Das Krankheitsstadium ist ein Indikator dafür, welches Behandlungsziel anzustreben ist.
Kurativ: Beim kurativen Ansatz besteht die Möglichkeit auf eine vollständige Heilung der Patient:innen. Ziel ist, möglichst alle Krebszellen zu beseitigen und eine dauerhafte Heilung zu erreichen.
Palliativ: Die palliative Chemotherapie erfolgt im fortgeschrittenen Krankheitsstadium, wenn es nicht mehr möglich ist, alle Tumorzellen zu beseitigen. Ziel ist es, das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen. Durch den palliativen Ansatz sollen bestimmte Beschwerden gelindert und das Leben der Patient:innen verlängert werden.
Adjuvante oder neoadjuvante Chemotherapie
Eine Chemotherapie kann auch mit anderen Behandlungen kombiniert werden. Ärzt:innen versuchen, wann immer möglich, einen Tumor durch eine Operation vollständig zu entfernen.
Adjuvant: Der adjuvante Ansatz schließt sich an eine Operation an und soll Krebszellen bekämpfen, die nach einer OP vielleicht im Körper verblieben sind, sich aber nicht nachweisen lassen. Durch diesen Ansatz soll das Risiko eines Rezidivs (Rückfall) verhindert werden.
Neoadjuvant: Der neoadjuvante Ansatz wird seltener eingesetzt. Er erfolgt vor der Operation, wenn der Tumor zu groß ist, um ihn direkt zu operieren. Durch die Chemotherapie lässt sich der Tumor häufig verkleinern (down sizing), wodurch sich die Operationsbedingungen verbessern.
Prof. (SHB) Hempel erklärt: „Auch beim Darmkrebs wird die adjuvante Chemotherapie eingesetzt. Nach der operativen Sanierung des Primärtumors erfolgt eine drei- bis sechsmonatige Chemotherapie, um das Risiko eines Rezidivs zu senken.“ Besonders bei Patient:innen, die ein hohes Risiko mitbringen, eine Metastasierung zu entwickeln, etwa, wenn bereits Lymphknoten befallen sind, der Primärtumor einen Darmverschluss verursacht hat oder eine Notfall-Operation nötig war, kommt die adjuvante Therapie zum Einsatz.
Welche Wirkstoffe werden bei der Chemotherapie angewandt?
Für die Behandlung von Darmkrebs gibt es eine Reihe von sehr gut erprobten und nachweislich wirksamen Zytostatika. Diese werden häufig in Kombination – oft auch in Kombination mit Antikörpern – eingesetzt, um den Tumor zu bekämpfen.
„In der Onkologie gilt die Faustregel: das wirksamste Mittel immer zuerst“, sagt Prof. (SHB) Hempel. Er ergänzt: „Beim Darmkrebs sind die zugelassenen chemotherapeutischen Substanzen gleich gut wirksam. Hier wird in Abhängigkeit der potentiellen Nebenwirkungen, der Chemotherapie-Kombinationspartner und der Tumorbiologie entschieden, welche Substanzen initial zum Einsatz kommen.“
Darmkrebs mit Chemotherapie behandeln
Nachdem die Diagnose Darmkrebs feststeht und bestimmt wurde, wie weit sich der Krebs bereits ausgebildet oder gestreut hat, werden die nächsten Behandlungsschritte mit der/dem Patient:in besprochen.
Wann ist eine Chemotherapie bei Darmkrebs sinnvoll?
Bei vielen Darmkrebspatient:innen ist die Chemotherapie eine ergänzende Behandlung zur Operation. Bei einer weit fortgeschrittenen Erkrankung ist sie sogar die wichtigste Maßnahme. Ob Darmkrebspatient:innen jedoch eine Behandlung mit Zytostatika erhalten, hängt vom Krankheitsstadium ab. Zudem spielt die Lage des Tumors eine wichtige Rolle, insbesondere, wenn eine Operation Teil der Therapie ist.
Auch wenn bestimmte Grundsätze für die Behandlung von Darmkrebs bestehen, so ist eine individuelle Therapieplanung für jede/n Patient:in in einem interdisziplinären Tumorboard unerlässlich und internationaler Standard. Das Tumorboard setzt sich aus Mediziner:innen verschiedener Fachrichtungen zusammen und berät gemeinsam, welche Therapie für die/den Patient:in die am besten geeignetste ist.
Chemotherapie in Tablettenform bei Darmkrebs?
Onkologische Therapeutika gibt es in verschiedenen Applikationsformen, etwa intravenös, oral, subkutan oder intramuskulär. „Bei der Behandlung von Darmkrebs kommen insbesondere intravenöse, seltener auch orale Therapieformen zur Anwendung, teilweise auch in Kombination“, so der Onkologe.
Intravenös: Per Infusion erhält die/der Patient:in die Chemotherapie direkt in die Vene oder über ein PORT Aggregat. Dies ist ein unter der Haut liegender, dauerhafter und sicherer Zugang zum Blutkreislauf, der von außen angestochen werden kann.
Oral: Der Chemotherapie-Wirkstoff kann auch oral eingenommen werden. Dies geschieht meist in Tabletten- oder Kapselform. Bei der oralen Einnahme müssen die Patient:innen weniger häufig ins Krankenhaus und bleiben etwas flexibler in ihrem Alltag.
Subkutan: Einige Patient:innen bekommen den Wirkstoff direkt in Form einer Spritze ins Unterhautfettgewebe, etwa im Bereich des Bauchs oder des Oberschenkels, gespritzt.
Intramuskulär: In seltenen Fällen wird der Wirkstoff direkt in den Muskel gespritzt, ähnlich einer Impfung.
Chemotherapie bei Darmkrebs: Ablauf ist individuell verschieden
Der Ablauf einer Chemotherapie bei Darmkrebs ist individuell verschieden. Lesen Sie hier, welche Voruntersuchungen gemacht werden, wie eine Chemotherapie abläuft und vieles mehr.
Welche Voruntersuchungen sind notwendig?
„Vor einer Chemotherapie sollten die Funktionen der lebenswichtigen Organe geprüft werden, also Leber, Lunge, Herz und Nieren“, so Prof. (SHB) Hempel. Dazu werden Blutuntersuchungen (Leber- und Nierenwerte) sowie diagnostische Untersuchungen (Ultraschall des Herzens, Lungenfunktion) durchgeführt.
Je nach geplanter Chemotherapie müssen für die einzelnen Substanzen noch spezielle Voruntersuchungen durchgeführt werden. Etwa ein Hörtest, da manche Medikamente bestehende Hörminderungen verschlechtern können.
Wie läuft die Chemotherapie ab?
Eine Chemotherapie verläuft in Intervallen, sogenannten Zyklen, bei denen sich Behandlungsphasen mit Behandlungspausen abwechseln. Je nach Allgemeinzustand, Erkrankung und Therapieform erhalten die/der Patient:in an einem oder mehreren Tagen Zytostatika. Im Anschluss folgt die Pause. In dieser Phase sollen die Medikamente wirken und der Körper kann sich von den Nebenwirkungen erholen. Danach beginnt ein neuer Zyklus.
Chemotherapie: Ambulant oder Stationär?
Sofern es möglich ist, erfolgt die Therapie ambulant, um Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Die/der Patient:in kommt morgens zur Behandlung ins Krankenhaus und kann danach wieder nach Hause gehen.
Ist die betroffene Person nicht mobil oder sind die Anfahrtswege zu lang und häufig, ist ein stationärer Aufenthalt sinnvoll. Der Vorteil: Die/der Patient:in wird intensiver überwacht, womit auf mögliche Nebenwirkungen schneller reagiert werden kann.
Aber auch eine Kombination aus ambulanter und stationärer Therapie ist möglich:
„Gerade zu Beginn einer Chemotherapie kann es eine gute Idee sein, stationär zu beginnen und bei guter Verträglichkeit ambulant fortzufahren“, sagt Prof. (SHB) Hempel.
Chemo in Kombination mit anderen Therapieformen?
Multimodale Therapie: Die systemische Chemotherapie erfolgt bei Darmkrebs meist in Kombination zweier oder dreier Zytostatika und Antikörpern. Bei der multimodalen Therapie wird eine Chemotherapie mit einer Operation und/oder Strahlentherapie kombiniert eingesetzt.
Antikörpertherapie: Die Antikörpertherapie ist eine der wichtigsten Entdeckungen in der Tumorforschung. Antikörper erkennen bestimmte Merkmale auf Zellen und binden sich an diese. Dadurch behindern sie den Stoffwechsel der Krebszellen, wodurch sich diese nicht weiter vermehren können.
Lokale Therapiemaßnahmen: Bei einer Operation, Bestrahlung oder auch Mikrowellenablation in Kombination mit einer Chemotherapie kann ein gutes Ergebnis für die/den Patient:in erzielt werden. Die Therapieplanung erfolgt im interdisziplinären Tumorboard.
Nebenwirkungen der Chemotherapie bei Darmkrebs
Da die Chemotherapie auch gesunde Zellen angreift, kommt es oft zu Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Erbrechen und Haarausfall, vor denen viele Patient:innen Angst haben. Die Nebenwirkungen können innerhalb weniger Stunden oder Tage nach dem Behandlungsbeginn auftreten. „Durch moderne Substanzen, die Übelkeit und Erbrechen deutlich abmildern, sind wir in der Lage, Nebenwirkungen gut zu beherrschen", sagt Prof (SHB) Hempel.
Haarausfall
Die häufigste Nebenwirkung ist immer noch der Haarausfall. In der Regel ist das Kopfhaar, seltener die Körperbehaarung, betroffen. Medizinisch ist Haarausfall während der Therapie unbedenklich, da die Haare am Ende der Behandlung wieder nachwachsen. Dennoch ist der Verlust der Haare für viele Patient:innen eine große psychische Belastung, da Außenstehende erkennen können, dass eine Krebserkrankung vorliegt.
Ansätze, in denen versucht wird, das Haar zu erhalten, etwa durch Kältehauben, sind in der Regel keine Kassenleistung, oft unangenehm und haben keine Erfolgsgarantie, meint der Chefarzt.
Alternativen können Perücken, welche zum überwiegenden Teil durch die Krankenkasse übernommen werden oder Tücher sein. „Hierfür lohnt der frühzeitige Termin bei einem Perückenmacher oder Friseur, bevor die Haare ausfallen. Der Haarausfall tritt in etwa zwei bis drei Wochen nach der ersten Chemotherapie ein“, rät Prof. (SHB) Hempel.
Übelkeit und Erbrechen
Krebsmedikamente wirken unterschiedlich auf Patient:innen, sodass dieselbe Dosis eines Krebsmittels bei verschiedenen Patient:innen zu unterschiedlich starker Übelkeit führen kann. Zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen können Patient:innen Medikamente von ihrem Arzt erhalten, um diese unerwünschte Nebenwirkung einzudämmen.
Zuhause können zudem Anti-Übelkeits-Medikamente und Tees helfen, die Übelkeit in den Griff zu bekommen. Sollte keine Besserung auftreten, ist der Anruf beim Arzt sinnvoll.
Unspezifische Nebenwirkungen
Auch unspezifische Nebenwirkungen, wie Abgeschlagenheit, Leistungsknick, Schwäche und Müdigkeit können im Rahmen der Behandlung mit Zytostatika auftreten. Hier kann regelmäßige körperliche Betätigung bis zur Belastungsgrenze hilfreich sein. Etwa in Form von Spaziergängen oder moderatem Radfahren.
Sollten diese oder andere Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.
Ernährung während der Chemotherapie
Das Thema Ernährung ist während der Chemo bei Darmkrebs besonders wichtig. Laut Prof. (SHB) Hempel ist es wichtig, dass Patient:innen ihr Gewicht halten. Das gelingt am besten mit Lebensmitteln, die der Patient gerne isst. Da sich der Geschmackssinn unter der Chemotherapie verändern oder vermindern kann, tritt oft Appetitlosigkeit auf. Prof. (SHB) Hempel rät dazu, individuelle Vorlieben zu berücksichtigen, die den Appetit erhalten. Zudem hat sie folgende Hinweise für Betroffene:
- Essen, was schmeckt und gut vertragen wird
- Auf eine ausreichende Trinkmenge achten
- Bei Gewichtsverlust zusätzlich hochkalorische Trinknahrung (Rücksprache mit Arzt halten) zu sich nehmen
- Obst und Gemüse schälen und dünsten
Worauf sollte man während der Chemo achten?
Prof. (SHB) Hempel hat für Betroffene hilfreiche Tipps, um das Immunsystem während der Chemotherapie zu schonen:
- Tägliche Körperpflege zur Keimreduktion auf der Haut
- Verbände nach der Körperpflege gegebenenfalls frisch machen und wechseln
- Mundpflege beachten und Zähne mit einer weichen Zahnbürste reinigen sowie pflegende Mundspülungen verwenden
- Bei Fieber oder anderen Zeichen eines Infektes (etwa Husten, Bauchschmerzen, Brennen beim Wasserlassen) sofort zum Arzt: durch das geschwächte Immunsystem kann eine Antibiotika-Gabe nötig sein
- Kontakte mit Menschen vermeiden, bei denen schwere Infekte bestehen
Wie sind die Erfolgsquoten einer Chemotherapie bei Darmkrebs?
Durch den Einsatz der adjuvanten Chemotherapie nach der Operation des Tumors im Darm kommt es zu einer signifikanten Reduktion des Rezidivrate und Erhöhung der Überlebensrate nach fünf Jahren.
Auch die palliative Chemotherapie kann aufgrund der vielen verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten sowie deren sequentieller Einsatz und die Kombination mit lokalen Therapiemaßnahmen das Leben vieler an unheilbarem Darmkrebs erkrankten Menschen mittlerweile um mehrere Jahre verlängern.
Wer trägt die Kosten der Chemotherapie bei Darmkrebs?
Die zuständige Krankenkasse übernimmt die Kosten über alle zugelassen (neo)adjuvant und palliativ eingesetzten Medikamente.
Chemotherapie bei Darmkrebs: So geht es danach weiter
Nach dem Abschluss der adjuvanten Chemotherapie erfolgen regelmäßige Nachkontrollen. Zunächst viermal jährlich in den ersten zwei Jahren.
Therapieformen individuell einsetzbar
Im Rahmen einer Darmkrebserkrankung erfolgt die Behandlung ganz individuell. Im Tumorboard entscheiden Mediziner:innen, welche Chemotherapie und weitere Behandlungsmaßnahmen für die Erkrankung am besten geeignet und erfolgversprechend sind.
Auch die gängigen Nebenwirkungen lassen sich durch Fortschritte in der Medizin erträglich gestalten und auf ein Minimum reduzieren.