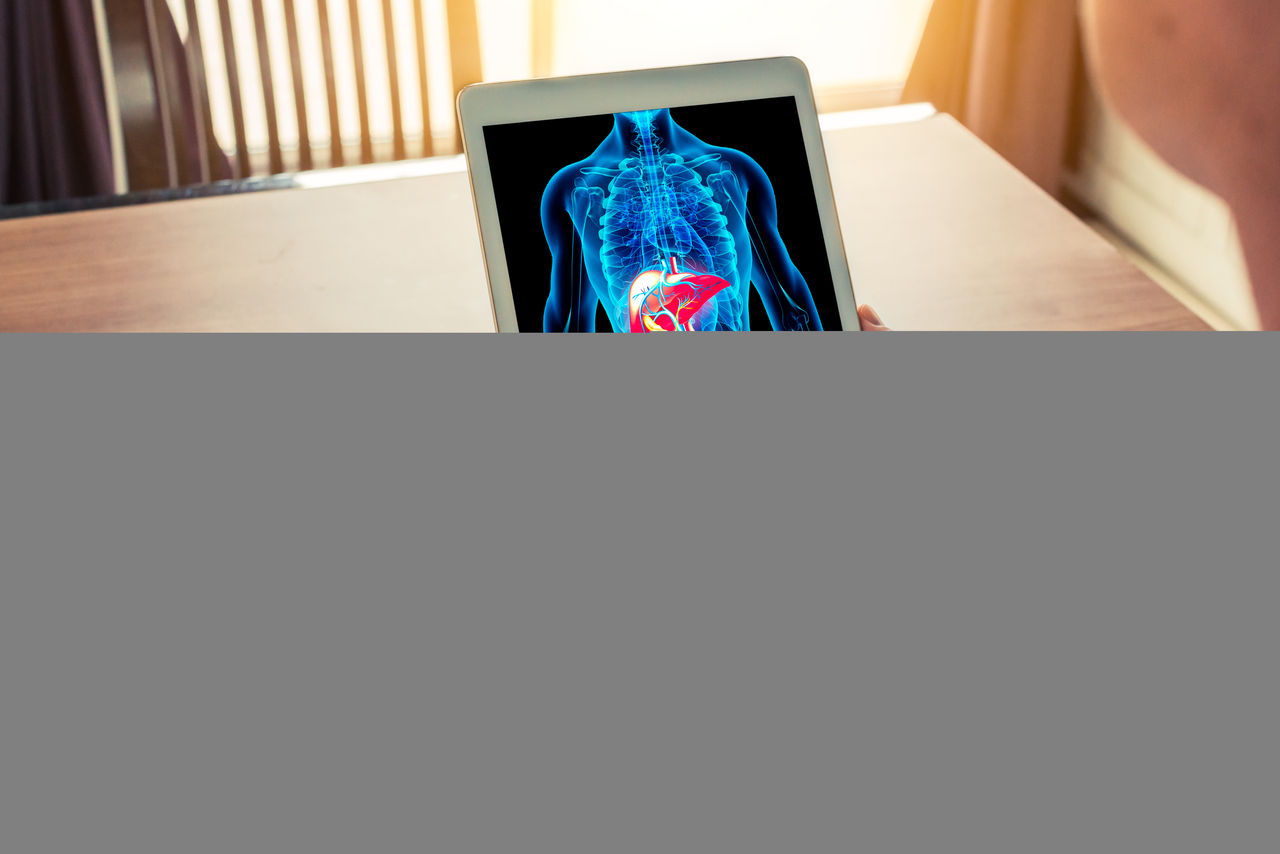Medikamentöse, endoskopische und chirurgische Behandlung bei Entzündungen sowie gutartigen und bösartigen Erkrankungen
Diagnostische Spiegelung des Gallenganges, endoskopische Entfernung von Gallensteinen und Therapie von Tumorens
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Verdauungssystems
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Verdauungssystems mittels flexibler Endoskope
Diagnostik und endoskopische Therapiemöglichkeiten
Alija Bukvic
(089) 8892-3011
Ivana Koroman
(089) 8892-21416