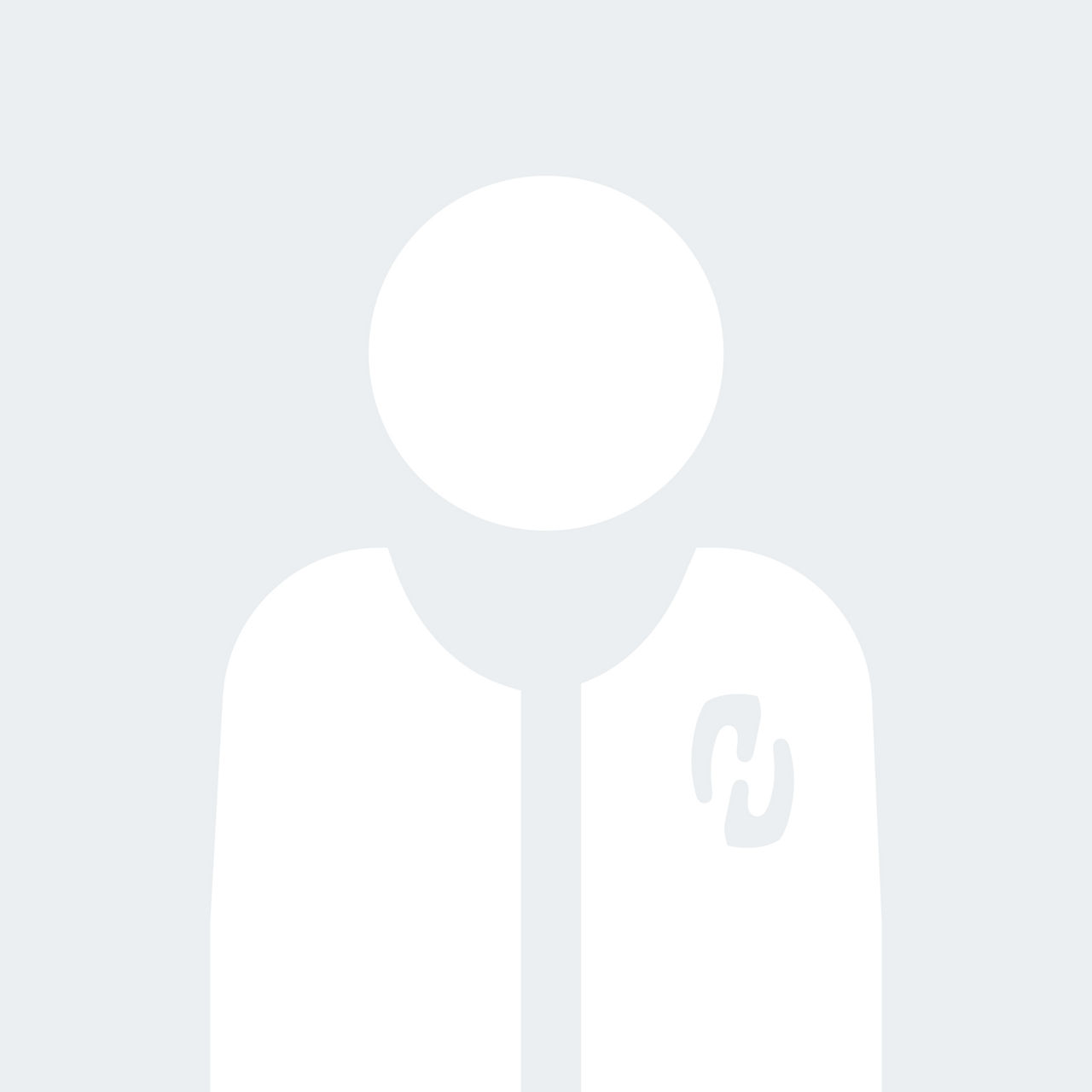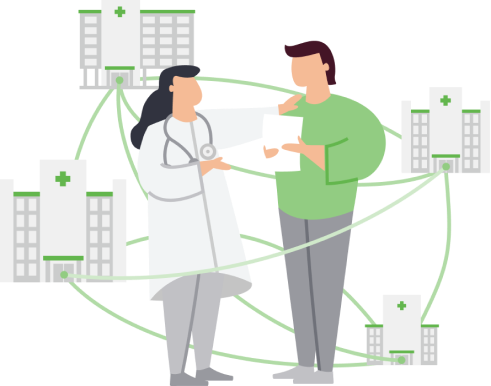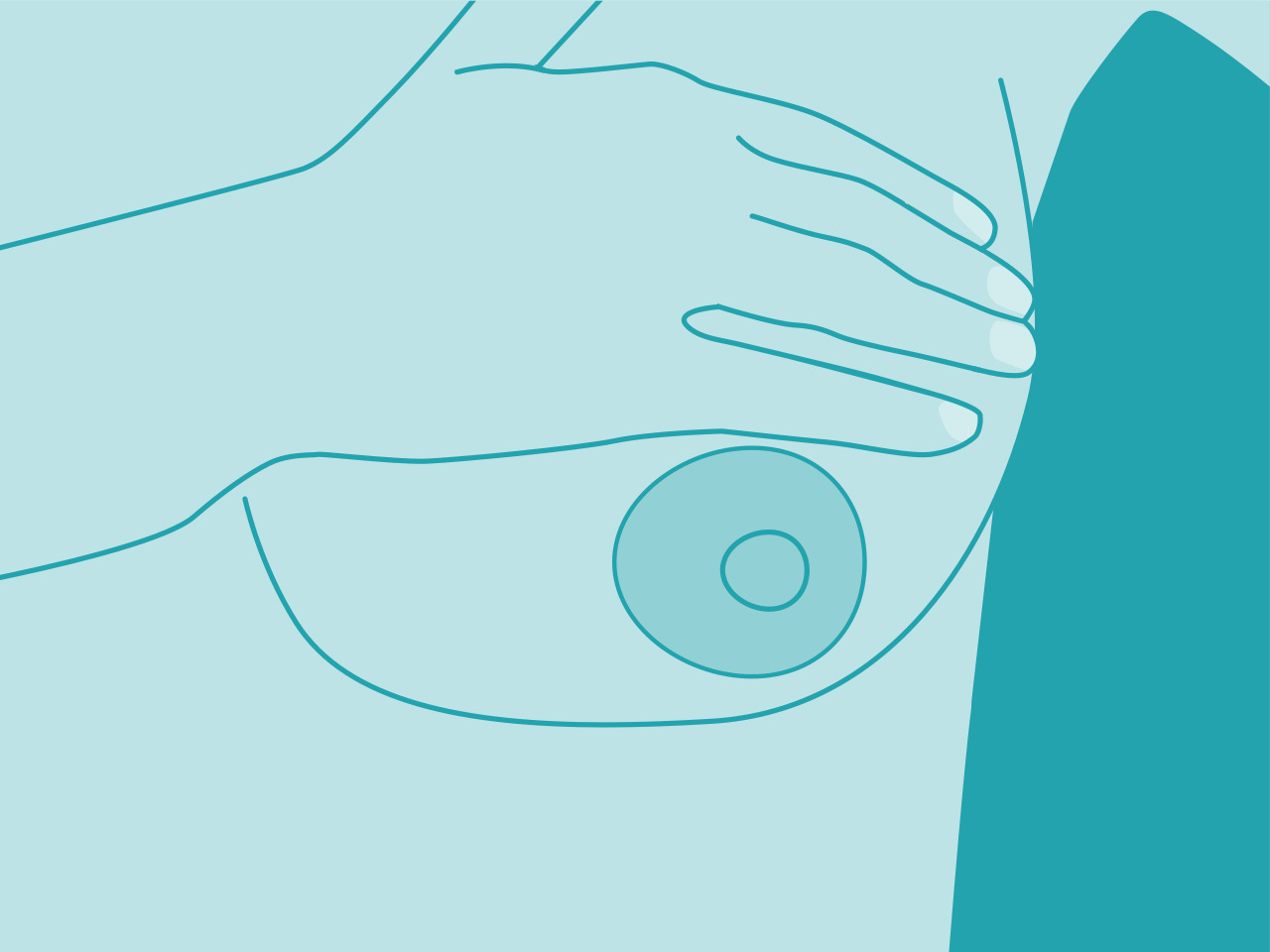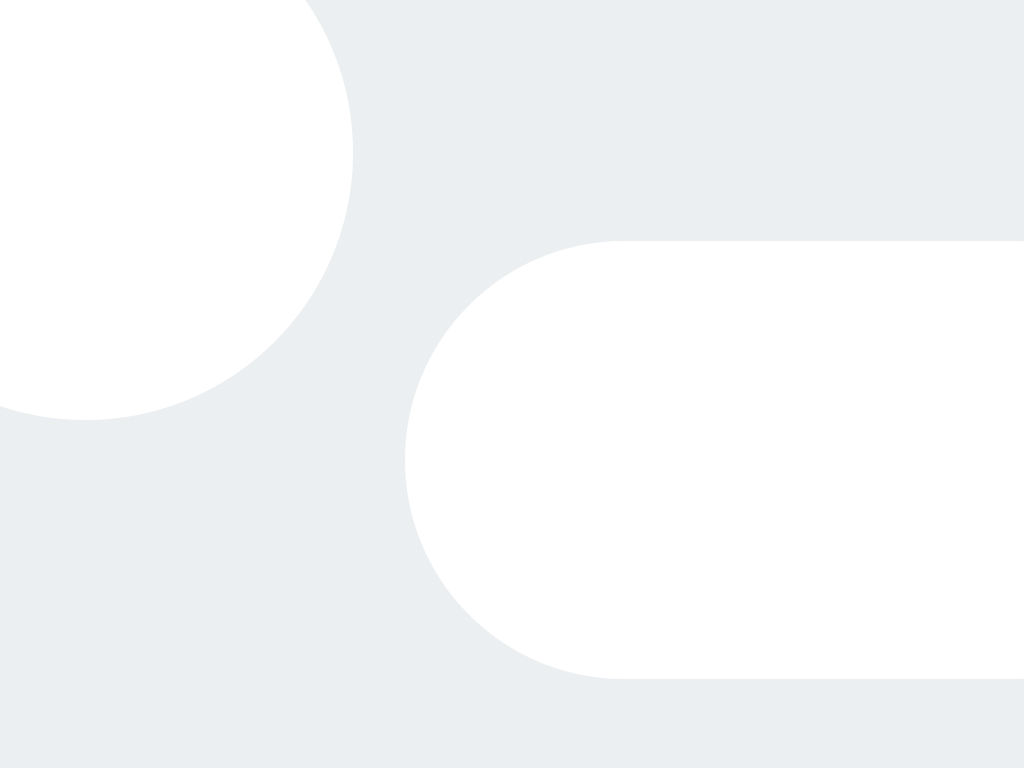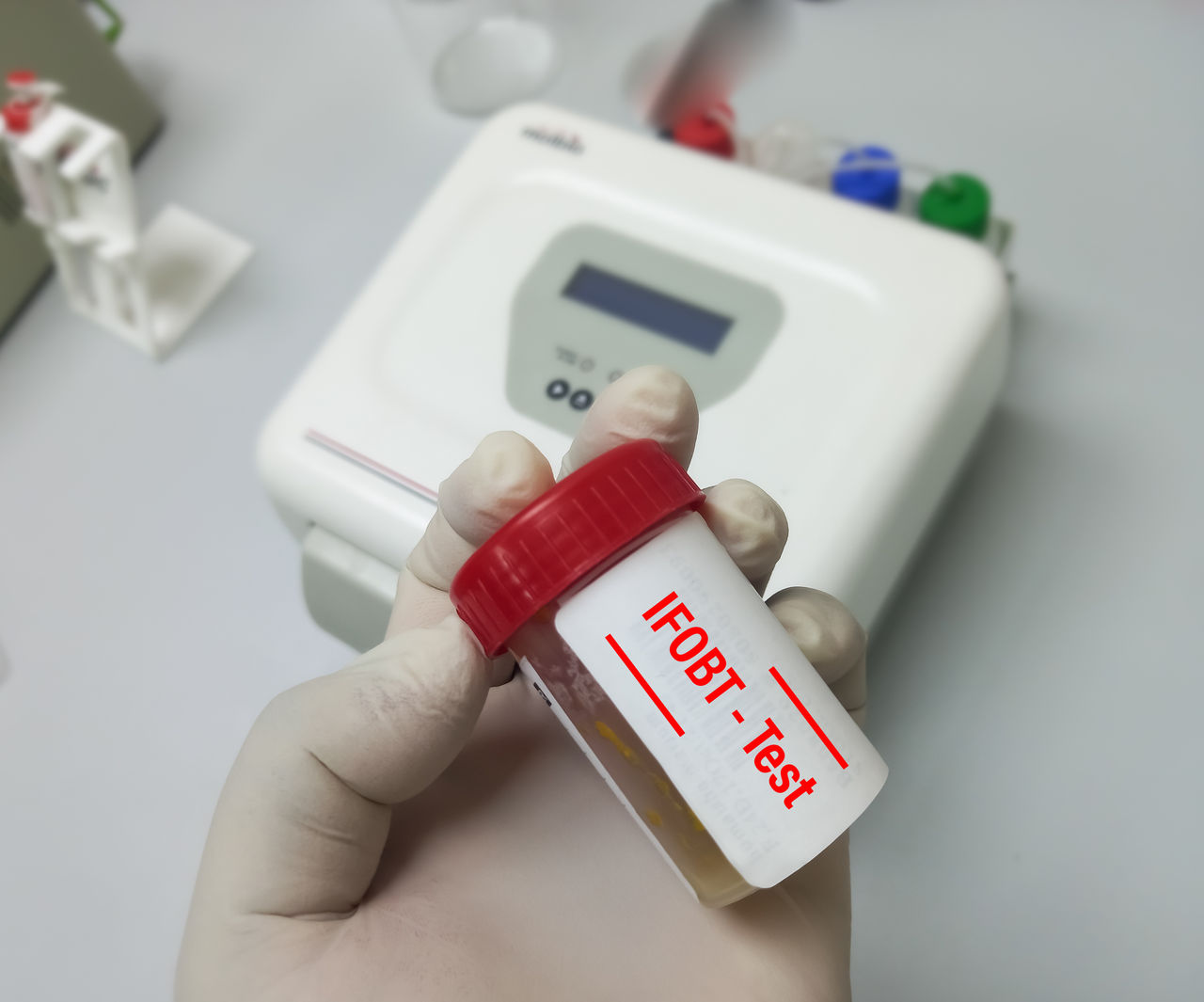Wann und warum sollte ich zur Reha?
Beim Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung wird zwischen einer stationären onkologischen Reha und einer Anschlussrehabilitation (AHB, früher: Anschlussheilbehandlung) nach beendeter Krankenhausbehandlung unterschieden. Erfolgt die Finanzierung über die Deutsche Rentenversicherung Bund, muss die AHB innerhalb von 35 Tagen nach beendeter Krankenhausbehandlung angetreten werden. Der Antrag muss spätestens 14 Tage nach Behandlungsende bei der Rentenversicherung eingegangen sein. Das Ende der Krankenhausbehandlung richtet sich nach dem individuellen Therapieschema und kann bei einer Operation der letzte Tag im Akutkrankenhaus sein, bei einer ambulanten Chemotherapie aber auch der Tag der letzten Infusion.
Im Gegensatz zur Anschlussrehabilitation kann eine stationäre onkologische Rehabilitation bis zu einem Jahr nach Abschluss der Akutbehandlung begonnen werden. Beide Reha-Maßnahmen dauern drei Wochen und können in der Regel nur stationär in einer Reha-Klinik erfolgen, nur in Ausnahmefällen auch teilstationär (ambulant). Es gibt einige Kliniken, in denen neben dem Partner auch Kinder als Begleitpersonen aufgenommen werden.
Was passiert bei der Reha?
Durch die Therapien in einer Reha-Klinik sollen Brustkrebspatientinnen für die Rückkehr in ihren Alltag gestärkt werden. Erkrankung und Behandlung haben ihnen viel abverlangt, nun geht es darum wieder Kraft zu tanken und Tipps sowie Hilfestellungen für das Leben nach und mit dem Brustkrebs zu erhalten.
Übliche Angebote sind daher die Ernährungsberatung, Sport- und Bewegungstherapien, psychologische Beratungen und Maßnahmen zur Krankheitsverarbeitung oder auch Beratungen für den beruflichen Wiedereinstieg.
Nach einer Brustkrebsbehandlung können zudem verschiedene medizinische Probleme auftreten, die durch Gynäkolog:innen oder Onkolog:innen versorgt werden sollten. Auch andere Fachärzt:innen wie Psychoonkolog:innen oder Therapeut:innen unterstützen Sie bei der Überwindung der Erkrankung. In Rehabilitationskliniken werden häufig folgende Beschwerden und Funktionseinschränkungen behandelt:
- Einschränkung von Kraft und Kondition (Mobilitätsstörungen) durch Muskelabbau
- Einschränkung der Beweglichkeit durch Gelenkprobleme, Schmerzen oder Muskelabbau
- Chemotherapie-bedingte Nervenstörungen (Polyneuropathie)
- Gleichgewichtsstörung durch Polyneuropathie oder Muskelabbau
- krankheits- oder therapiebedingtes Erschöpfungsgefühl (Fatigue-Syndrom)
- brustprothetische Versorgungsprobleme
- hormonelle Entzugserscheinungen
- Lymphödeme
- Konzentrations- und Schlafstörungen
- Luftnot bei eingeschränkter Herz- und Lungenfunktion
- Ängste oder Depressionen
- Schmerzen
- Wundheilungsstörungen
- sexuelle Störungen
Auch zu weiteren gesundheitlichen Begleitproblemen oder wichtigen Risikofaktoren werden Ihnen unterstützende Angebote gemacht:
- Übergewicht
- Untergewicht
- Diabetes mellitus
- Nikotinkonsum
Krankheit und Beruf
Die Klärung der beruflichen Situation während der Rehabilitation ist ein oft unterschätztes Thema. Während der Rehabilitation werden wichtige beruflich relevante Belastungspunkte und Lösungsansätze besprochen. Es gibt unterstützende Therapien, Schulungen und Beratungen in Hinblick auf den Beruf. Auch der konkrete berufliche Wiedereinstig oder eine Erwerbsminderungsrente werden Thema sein.
Die Patientinnen werden die berufliche Situation und Belastbarkeit durch die Rehabilitation besser einschätzen können. Die ärztliche Einschätzung der beruflichen Belastbarkeit dient wiederum der Rentenversicherung als wichtige Entscheidungsgrundlage für die Leistungen der Renten- und anderer Sozialversicherungsträger.
Besondere Möglichkeiten einer stationären Rehabilitation
Die Verarbeitung und Bewältigung einer Tumorerkrankung erfordern häufig Kraft und auch wichtige Entscheidungen. Die Zeit und Ruhe während der Rehabilitation nutzen viele Patientinnen, um ihre Krankheits- und Lebenssituation neu zu überdenken. Sie spüren oft wieder zunehmende körperliche und seelische Kräfte und können ihre eigenen Möglichkeiten, aber auch die weiter bestehenden Grenzen mit Blick auf die Zukunft besser einschätzen. Das Gespräch mit erfahrenen Ärzt:innen, Psycholog:innen, Therapeut:innen und Pflegekräften bietet dafür einen sinnvollen Rahmen.
Aber auch das besondere Umfeld einer Klinik spielt eine große Rolle und kann diesen Krankheitsbewältigungsprozess fördern. Spaziergänge in der Natur, das Zusammensitzen abends im kleinen Kreis oder auch eine Kunstwerkstatt sind wichtige Gelegenheiten, um mit anderen Patientinnen ins Gespräch zu kommen. Der Austausch unter Betroffenen ist dabei von unschätzbarem Wert. Viele Patientinnen sind positiv überrascht, wie hilfreich diese Kontakte für die Seele, aber auch für praktische Alltagsfragen im Umgang mit der Erkrankung sind. Oft werden auch Schulungen von Patientenorganisationen angeboten, in denen alltagspraktische, aber auch intime Fragen in Zusammenhang mit der Erkrankung im geschützten Rahmen angesprochen werden können. Eine stationäre Rehabilitation stellt somit auch eine wichtige Chance zur Krankheitsbewältigung dar.
Wer übernimmt die Kosten für die Reha?
Die Kosten für eine Reha werden bei gesetzlich versicherten Patientinnen von den gesetzlichen Krankenkassen oder der gesetzlichen Rentenversicherung übernommen. Privat versicherte Patientinnen müssen die Kostenübernahme mit ihrer Versicherung klären.
Bei Beamten erfolgt die Finanzierung über die private Krankenversicherung sowie ihrer Beihilfestelle.
Für den Aufenthalt in einer Anschlussheilbehandlung hat man nur längstens über einen Zeitraum von 14 Tagen eine Zuzahlung zu leisten, wobei die Zuzahlung für den stationären Aufenthalt im Krankenhaus angerechnet wird.
An wen kann ich mich wenden?
Der Antrag für die Rehabilitation nach einer Brustkrebsbehandlung sollte bei der Krankenkasse gestellt werden. Wenn nötig, wird er von dort an den zuständigen Kostenträger weitergeleitet. Erfolgt die Reha in Form einer Anschlussrehabilitation, so wird der Antrag vom Sozialdienst des behandelnden Krankenhauses gestellt.
Nachsorgeuntersuchungen: Warum sind sie wichtig?
Nach der beendeten Brustkrebsbehandlung ist es wichtig, dass die Patientinnen über einen Zeitraum von zehn Jahren regelmäßig unterschiedliche Nachsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Nur so kann ein Rezidiv (eine erneute Erkrankung an Brustkrebs) rechtzeitig erkannt und behandelt werden.
Zudem dient die Nachsorge:
- der Kontrolle der medikamentösen Nachbehandlungen und deren Nebenwirkungen
- der Erkennung von Neuerkrankungen derselben Brust oder der Gegenseite
- der Erkennung anderer Krebserkrankungen
- der Beratung (Verhütung, Hormone, Komplementärmedizin, familiäre Belastung, Kinderwunsch)
Regelmäßige Nachsorgetermine sind zudem wichtig, um eventuell auftretende Spätfolgen der Therapie rechtzeitig zu erkennen und eine wirksame Therapie einzuleiten. Die behandelnden Ärzt:innen untersuchen die behandelte und die gesunde Brust und schauen sich einmal jährlich mit einem bildgebenden Verfahren (Mammographie, Brustultraschall) das Brustgewebe an. Darüber hinaus sollten Betroffene regelmäßig ihre Brust selbst abtasten.
Wann ist Nachsorge notwendig oder empfehlenswert?
Alle Brustkrebspatientinnen sollten in den ersten zehn Jahren nach Ende der Primärtherapie die Nachsorge wahrnehmen [1]. Die Untersuchungen sind in folgenden Zeitabständen sinnvoll [2]:
Die Nachsorgeuntersuchungen werden in der Regel von den behandelnden Gynäkolog:innen oder Onkolog:innen koordiniert, gegebenenfalls bieten auch Brustzentren die Koordination an. Die bildgebende Diagnostik (zum Beispiel Mammographie, Sonographie) führen Radiolog:innen durch.
Die Zeit nach dem Brustkrebs
Die Zeit nach der Brustkrebstherapie ist für die meisten betroffenen Frauen überschattet von der Erkrankung. Ihr Leben ist auf den Kopf gestellt worden, in vielen Bereichen warten neue Anforderungen auf sie.
Psychosexuelle Beratung
Nach der Diagnose Brustkrebs spielen sexuelle Wünsche nicht selten nur noch eine nachrangige Rolle. Denn für die Frauen bedeutet der Tumor, dass sie unvermittelt in eine Situation geraten, in der sie nicht nur Angst und Schmerzen verarbeiten müssen. Die subjektive Wahrnehmung ist verändert: Durch die Operation hält sich die Patientin eventuell nicht mehr für attraktiv oder fühlt sich nicht mehr als Frau – sogar, wenn der Partner das gar nicht so empfindet. Gespräche mit dem Partner und der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt können helfen.
Eine weitere Möglichkeit ist die psychoonkologische Beratung und Begleitung, die an vielen Kliniken angeboten wird. Hier wird auf die individuellen Bedürfnisse und Probleme der Betroffenen eingegangen und es werden gemeinsam Lösungswege und Möglichkeiten zur Selbstfürsorge entwickelt.
Kinderwunsch und Schwangerschaft bei Frauen mit Brustkrebs
Grundsätzlich ist eine optimale Behandlung von Brustkrebs auch bei schwangeren Frauen möglich. Wenn bei einer Brustkrebsbehandlung Kinderwunsch besteht, sollten einige Regeln beachtet werden: Vor einer Chemotherapie sollten Brustkrebspatientinnen ihren Kinderwunsch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt besprechen.
Die Eierstockfunktion kann während einer Chemotherapie durch sogenannte GnRH-Analoga geschützt werden. Frauen haben zudem die Möglichkeit, befruchtete oder unbefruchtete Eizellen beziehungsweise Eierstockgewebe vor Beginn der Chemotherapie entnehmen und einfrieren zu lassen.
Bewegung und Sport bei Brustkrebs
Bewegung und Sport bewirken ein besseres Allgemeinempfinden und unterstützen die körpereigene Abwehr. Auf Sport und Bewegung müssen Frauen auch nach einer Brustkrebsoperation nicht verzichten. Richtig angegangen, kann Sport den Heilungsprozess sogar fördern.
Allerdings: Brustkrebspatientinnen sollten langsam anfangen und vorab mit dem behandelnden Arzt über ihre sportliche Betätigung sprechen. Als sehr angenehm wird die Wassergymnastik empfunden, da hier die Übungen sanft und fließend durch das Wasser unterstützt werden. Empfohlene Ausdauersportarten sind Wandern, Schwimmen und Nordic Walking.
Sozialberatung und Patientenservicecenter
Nach einer schweren Erkrankung oder einem langen Aufenthalt im Krankenhaus sind Patientinnen manchmal auf Hilfe angewiesen, um ihren Alltag zu bewältigen. In solchen Fällen stehen die Sozialberatung und das Patientenservicecenter zur Seite und suchen gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Angehörigen nach Lösungen. So unterstützen die Mitarbeiter beispielsweise bei allen sozialen Fragen wie der Organisation einer Anschlussheilbehandlung sowie der Beratung zum Schwerbehindertenrecht.