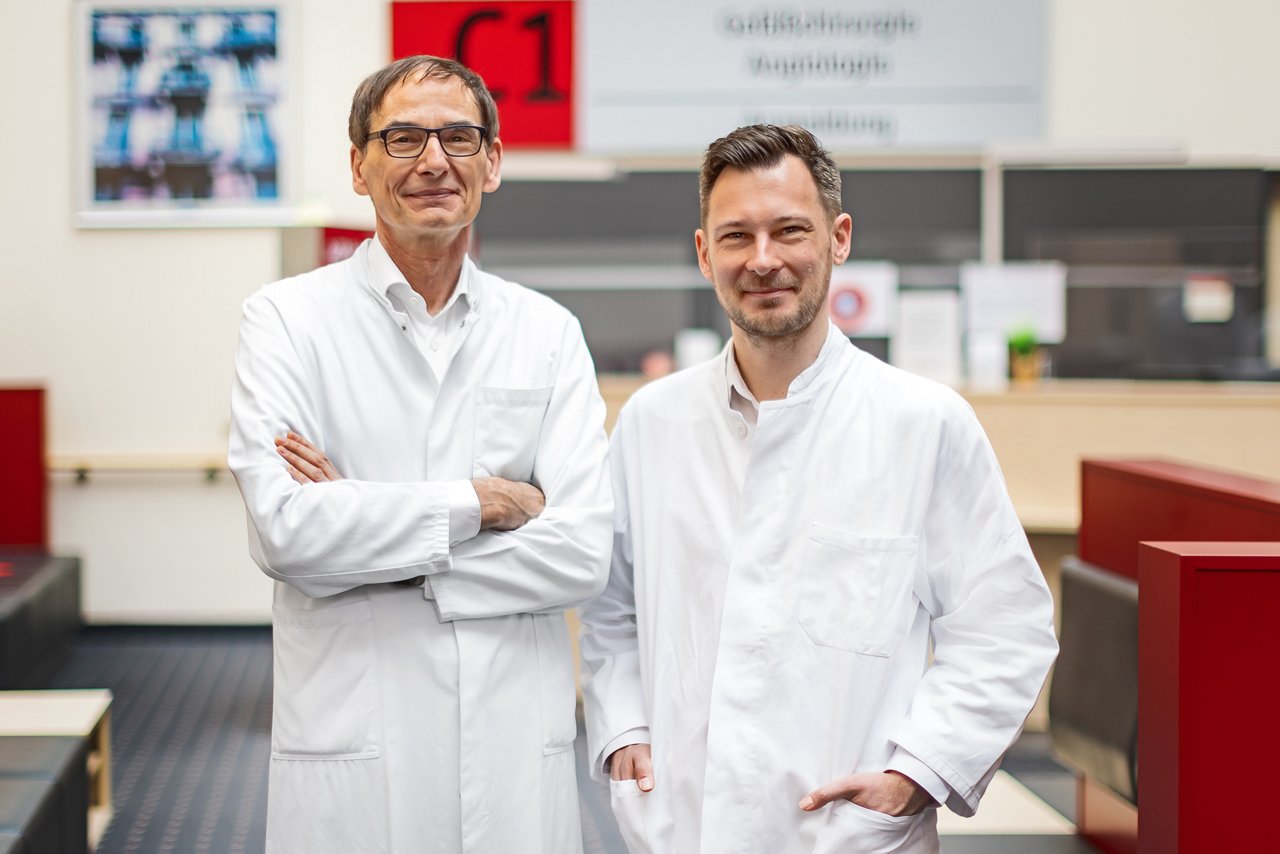


- Venöse Thrombosen und Lungenarterienembolien
- Chronische venöse Insuffizienz, Varikose und Unterschenkelgeschwüre
- Vaskulitiden (venöße Gefäßentzündungen)
- Gefäßmalformationen
- Shuntanlagen, -korrekturen und -interventionen
- Implantation von Port- und Vorhofkathetern
- Lymphgefäßerkrankungen und chronische Ödemerkrankungen
- Gefäßmalformationen
Auf Wunsch führen wir auch Zweitmeinungsverfahren durch.
Flyer Interdisziplinäres Gefäßzentrum Berlin-Buch
Burglind Dammrich
(030) 94 01-54960
Auf dem ersten Gefäßsymposium präsentierte sich das Helios Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg Zuweisenden, Multiplikator:innen sowie Fachpublikum. Im Rahmen der gelungenen Auftaktveranstaltung stellten die drei Helios Standorte Berlin-Buch, Berlin-Zehlendorf und Bad Saarow nicht nur aktuelle Entwicklungen und Behandlungskonzepte der wichtigsten gefäßmedizinischen Krankheitsbilder vor, sondern hoben auch die Vorzüge des Zentrums für Gefäßpatient:innen hervor.



